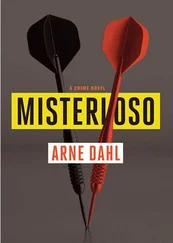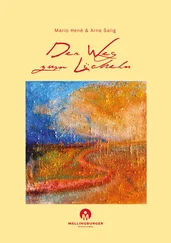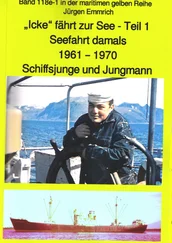Nun war ich mit Schälen fertig und warf die Kartoffelschalen einfach Über Bord. Doch der Kapitän belehrte mich: „Über Bord darf im Hafen nichts geworfen werden. Das kostet 10 Mark Strafe, wenn man dich erwischt.“ Ich kümmerte mich aber nicht darum, denn ich wusste ja nicht, wo ich mit den Schalen bleiben sollte. Darüber gab mir der Kapitän keine Auskunft. Also blieb ich bei meiner Über-Bord-Methode. Das galt natürlich für alles andere, wie Asche und sonstige Abfälle auch.
Die Kartoffeln wurden aufgesetzt, und ein Topf wurde mir gezeigt, in dem Fleisch geschmort wurde. Meine Aufgabe war es nun, das Fleisch nicht anbrennen zu lassen. Alles Übrige machte der Kapitän.
Während die Kartoffeln kochten, fegte ich das Mannschaftslogis aus und brachte es in Ordnung. Meine Koje war inzwischen frei geworden und wurde von mir hergerichtet. Ich bezog die obere Querschiffskoje. Die beiden unteren Kojen blieben Älteren Dienstgraden vorbehalten. Jede Koje hat nämlich ihren Wert und damit auch einen Rang. Der beste Schlafplatz war die untere Längsschiffskoje, die schlechteste die obere Querschiffskoje. Querschiffskojen haben den Nachteil, dass man beim Krängen des Schiffes, d. h., wenn es zur Seite geneigt war, was im Hafen beim Be- und Entladen vorkam, zuweilen mit dem Kopf nach unten lag, was nicht sehr angenehm war. Auch wurde auf bewegter See das Schlingern stärker empfunden. Die Frage, ob nun eine obere Längsschiffskoje oder eine untere Querschiffskoje besser sei, wird meistens zugunsten der unteren entschieden. Unten zu schlafen ist vornehmer. So war denn die Rangfolge bei der Mannschaft an der Kojenbelegung abzulesen. Der 25jährige Eugen war der Älteste und fuhr als Bestmann, der gleichzeitig die 300 PS starke Maschine zu warten hatte. Hein war der Leichtmatrose, von Beruf Bäcker und etwa gleichaltrig mit Eugen. Manfred als frischgebackener Jungmann schlief in der oberen Längskoje.
Mein Kojenzeug war bescheiden. Eine dünne grüne Friesdecke bildete die Unterlage auf einer Matratze, die auf Brettern lag. Zum Zudecken hatte ich eine graue Militärdecke mit dem roten Streifen an einem Ende und einem blauen am anderen Ende. Als Kopfkissen diente eine Schwimmweste, die in jeder Koje lag. Geschlafen wurde im Unterzeug. Die anderen hatten keine bessere Ausstattung, denn in „weißem Kojenzeug“ schlief niemand, die Bettwäsche wäre auch zu aufwendig an Bord gewesen.
Nach dem Mittagessen wurde wieder Backschaft gemacht und anschließend die Kombüse gescheuert. Das geschah mit einem Leuwagen, den man an Land Schrubber nennt. Damit ging ich mit etwas Ata den schwarzen und weißen Fliesen zu Leibe. Aber dem Kapitän gefiel meine Arbeitsweise nicht. „Du hast wohl bei deiner Großmutter scheuern gelernt? An Bord macht man das so.“ Er nahm mir den Leuwagen aus der Hand und tanzte wie eine aufgezogene Puppe mit dem Leuwagen in Windeseile von einer Fliese zur anderen. Ich musste es genauso machen und kam dabei ganz schön ins Schwitzen.
Anschließend war etwas Zeit, meine Sachen in den Schrank zu ordnen. Es war nicht viel, das meiste vom Vater, der als vermisst galt und für tot erklärt worden war. So nach und nach wollte ich mir einiges von der Heuer kaufen.
Hein und Manfred waren unterdessen mit Malen beschäftigt. Das Schiff war grau gestrichen, und die Verschanzung bekam einen neuen Anstrich. Das Malen ist überhaupt eine ständige Tätigkeit an Bord, denn das Schiff konnte nur stückchenweise von der Mannschaft gestrichen werden. Ein Anstrich in der Werft wäre zu teuer gewesen.
Am nächsten Tag verholten wir in den Roßhafen. Zunächst mussten wir aus dem Päckchen herausmanövrieren. Dabei wurde das Päckchen von fünf oder sechs neben uns liegenden Schiffen in das Hafenbecken hinausgeschoben, bis wir einen freien Ausgang hatten. Das unmittelbar neben uns liegende Schiff holte danach das Päckchen wieder an die Kaimauer zurück.
Mitten im Roßhafen lag ein großes amerikanisches Schiff, ein sogenanntes Liberty-Schiff, das 10.000 Tonnen Weizen geladen hatte, der von vier schwimmenden Getreidehebern, die auf jeder Seite vorne und achtern ihre Saugrüssel in die Laderäume gesenkt hatten, in die kleinen Schiffe umgeladen wurde. Der Weizen kam im Rahmen der Marshall-Plan-Hilfe aus Amerika, die 1948 in Kraft gesetzt wurde. Diese Liberty-Schiffe nannte man auch 99-Tage-Schiffe, weil sie während des Krieges in 99 Tagen gebaut wurden, um die großen Tonnageverluste durch den UBootkrieg auszugleichen. Schiffe solcher Größe besaß Deutschland nicht mehr. Alle Schiffe mit mehr als etwa 1.000 bis 2.000 Ladetonnen gingen im Rahmen der Reparationsleistungen vorwiegend nach England.
Der Weizen strömte nun unablässig in den Laderaum, den die Mannschaft zu trimmen hatte. Längs der Mitte des Laderaumes war aus Bohlen eine Trennwand eingezogen worden, um ein seitliches Verrutschen der Ladung zu verhindern, denn das Schiff könnte dadurch in Schieflage geraten und dabei kentern. Das große Segelschiff „PAMIR“ ist auf diese Weise im Sturm auf dem Atlantik gekentert und untergegangen. Mit Schaufeln und Händen wurde diese kostbare Fracht in alle Winkel verteilt, um möglichst viel in das Schiff aufnehmen zu können. Es war ein ungewöhnliches Gefühl, in so viel Weizen zu sitzen, wo die Leute an Land für eine Tüte voll schon dankbar gewesen wären. Es wurde auch viel mit Weizen schwarz gehandelt, der auf solchen Transporten gestohlen wurde, und auch unsere Mannschaft hatte bei früheren Ladungen einen ganzen Sack voll Weizen an Land gehen lassen. Polizei und Zoll hatten viel zu tun, um das kostbare Gut aus Amerika auf den gesetzlichen Wegen zu halten.
Am Abend war das Schiff voll beladen, und wir machten uns sogleich auf die Reise elbeabwärts. Es war auslaufender Strom, denn wir hatten den Höhepunkt der Tide überschritten, und das Wasser strömte zurück in die Nordsee. Die Schiffe richten sich beim Ein- und Auslaufen immer nach dieser recht starken Strömung, um schneller den Hafen oder das offene Meer zu erreichen.
Während der Fahrt wurden die Luken geschlossen. Schwere Holzbohlen wurden auf die quer zum Schiff liegenden Scherstöcke gelegt. Dann wurde eine Persenning, das ist eine Plane, über die Luken gelegt, deren Ränder mit Eisenlatten und Keilen verschalkt wurden. Schließlich wurde das Deck gefegt, und unser Schiff war seeklar. Ruhig lag das Schiff auf der Elbe, deren Wasser seitlich durch die Speigatten auf das Deck spülten. Wie mag das wohl bei Seegang aussehen?
Nach dem Abendbrot legte ich mich in meine Koje und schlief ein. Etwa um Mitternacht wurde ich geweckt. Ich sollte ins Ruderhaus kommen. „Wir haben jetzt Cuxhaven achteraus“, sagte der Kapitän, blieb mir aber eine Erklärung für meine Anwesenheit dort oben schuldig. Immerhin war es für mich neu, nachts auf einem fahrenden Schiff im Ruderhaus zu stehen, und so freute ich mich an den Lichtern der vielen ein- und auslaufenden Schiffe. Es war dunkel, und es wurde kaum gesprochen. Manfred stand am Ruder, er ging die erste Wache. Das Schiff fuhr ganz ruhig, aber nach einiger Zeit kam etwas Bewegung in das Schiff, bis es in ziemlich regelmäßigem Auf und Nieder seinen Kurs auf die Nordsee nahm. Mich überfiel eine starke Müdigkeit, die ich zunächst mit der nächtlichen Stunde zu erklären suchte. Meine Glieder wurden schwerer und schwerer, es machte mir Mühe die Augen offen zu halten. Ein merkwürdiges Gefühl überkam mich. Es lag später zwischen Müdigkeit und Übelkeit. Die Bewegung des Schiffes wurde stärker. Anfangs konnte ich sie noch durch Gegenbewegung des Körpers ein wenig ausgleichen. Doch nun gewannen sie die Oberhand und schaukelten meinen müde und schlaff gewordenen Körper hin und her. „Darf ich jetzt wieder schlafen gehen?“ fragte ich. Der Kapitän erlaubte es und trug mir auf, Eugen zu wecken, damit er die nächste Wache antrete. Der Steuermann war auch schon auf der Brücke, um den Kapitän abzulösen. Es war 12 Uhr nachts. Ich eilte nach vorn, die auf- und niedergehende Schiffbewegung war dort viel stärker als achtern zu spüren, und ich merkte, dass mir sehr übel wurde und ich sogar einen Brechreiz verspürte. Mein einziger Gedanke war: Schnell in die Koje! Aber Eugen musste noch geweckt werden, doch als ich ihn ansprechen wollte, kam statt der Worte das Abendbrot aus meinem Munde. Ich war seekrank! Nun war mir alles egal. Eugen war wach, der Fußboden beschmutzt, und ich lag apathisch in der Koje. Man nahm aber keinen Anstoß daran.
Читать дальше