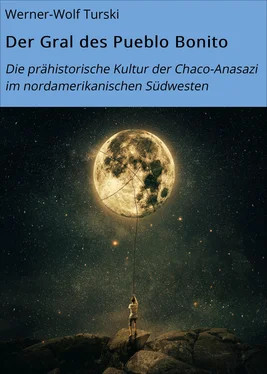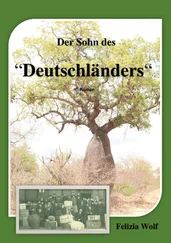Weiber, die in einem bestimmten Revier eine bestimmte Keramik herstellten, konnten mit Zustimmung oder in Abstimmung auch von ihrer Gemeinschaft in eine andere Gemeinschaft wechseln und dort weiter die ihnen gewohnte Keramik fertigen. Nicht das Gefäß „wanderte“ weg, sondern die Produzentin. In der neuen Gemeinschaft wurde ihr Gefäßfertigungsstil vielleicht auch von deren Weibern übernommen.
In diesen Zusammenhang gehört auch der offizielle, von der Gemeinschaft gebilltigte Wechsel von Personen von der „eigenen“ Gemeinschaft in die „fremde“ Gemeinschaft - eine Erscheinung, die in der Literatur gern mit dem Begriff „exogame Eheschließung“ bezeichnet wird. Die Menschen kannten sexuelle Beziehungen und deren verbindende Wirkung, aber keine Ehe in unserem heutigen patriarchalen Sinn. Ein Personenwechsel von einer Gemeinschaft zu einer anderen erfolgte in Abstimmung der beiden Gemeinschaften und orientierte sich an den biologisch und auch gesellschaftlich determinierten Lebenserhaltungsbedürfnissen der (beiden) Gemeinschaft(en). Das war kein Menschenhandel! Einen Gemeinschaftswechsel konnten sowohl Weiber als auch Männer vollziehen. Die Weiber waren aber biologisch „wertvoller“ als ein Mann.
Die Weitergabe/die „Wanderung“/das „Abdriften“ von „Exotika“ konnte vom „Ersterwerber“ weiter über Gruppe zu Gruppe erfolgen oder durch eine Beschaffungslangstrecken-„Expedition“ ausgewählter Mitglieder einer „bedürftigen“ Reviergemeinschaft auf direktem Weg verlaufen. Zwischen dem Herkunftsort eines „Exoten“ und seinem Fundort/Verarbeitungsort können Hunderte Kilometer liegen und die das Material am Ursprungsort aufhebende Gruppe brauchte absolut keine Kenntnis von der das Material empfangenden Gemeinschaft (am archäologischen Fundort) zu haben. So „driftend“ wie die Wanderwege der Gemeinschaften entlang geographischer Linien und Ressourcenverläufe waren, waren auch die „Bezugswege“ exotischer Materialien.
Während die Weitergabe/der Weitertransport kleiner Mengen „Exotika“ (man muss immer die relativ geringe Transportkapazität der Nomaden beachten!) als „Gastgeschenkreserve“ sehr plausibel ist, gibt es für Beschaffungslangstrecken-„Expeditionen“ nur vereinzelte Beispiele (z.B. die mindestens 700 km lange Wanderung der Mimbres zum Golf von Kalifornien; Anasazi- und Mimbreswanderungen über Hunderte Kilometer bis in den tropischen Urwald von Mesoamerika zum Erwerb von Aras). Es ist auch von anderen/weiteren zielgerichteten Beschaffungsexpeditionen auszugehen (eventuell Türkisbeschaffung, Beschaffung von Feuerstein, Chalzedon, Obsidian u.ä.), aber da steht das Problem der archäologischen Nachweisfähigkeit. Es muss auch grundsätzlich bekannt gewesen sein, dass im Süden, in Mesoamerika „gutes Land“ liegt, denn trotz des chaotischen Charakters der Wanderbewegungen war ein grundsätzlich südwärts gerichtetes Vordringen von Menschen der uto-aztekischen Sprachgruppe bis ins heutige Nikaragua zu verzeichnen. Ebenso ist von nordwärts gerichteten Wanderungsdriftwirbeln auszugehen, über die Erfahrungen (u.a. Kultigene wie Mais, Kürbis und Bohnen und ihre Nutzungsmöglichkeiten) und Objekte aus Mesoamerika, wie Kupfergegenstände, in den Norden, den nordamerikanischen Südwesten, gelangten. Die geringe Quantität dieser Objekte und deren Verteilung über Raum und Zeit schließen einen apostrophierten Handel aus.
Die gesellschaftliche Struktur der Menschengemeinschaften der Basketmaker-Zeit war grundsätzlich egalitär. Führungsaufgaben in der Gemeinschaft und Verantwortung für das „Wohlergehen“ der Gemeinschaft oblagen weiblichen und männlichen Personen mit allgemein anerkannter physischer, mentaler und/oder spiritueller Kompetenz. Jeder Mensch wurde entsprechend seinen Fähigkeiten und deren Einsatz im Sinne der Gemeinschaft geachtet. Die Alten wurden als spezielle Erfahrungsträger und –vermittler geachtet, die Kinder bildeten das biologische Zukunftspotenzial der Gemeinschaft und wurden entsprechend gepflegt und ausgebildet. Die Weiber stellten das biologische Reproduktionspotenzial und wirderspiegelten damit die Lebensfähigkeit der Gemeinschaft dar. Der Erhalt der Lebensfähigkeit der Gemeinschaft und damit die Achtung der Weiber und der von ihnen vertretenen physischen und spirituellen Lebensprinzipien war der ungeschriebene, aber dominierende Faktor im Leben der Gemeinschaft.
Jede Person hatte sich mit ihrer Leistungsfähigkeit voll für die Aufgaben der Gemeinschaft einzusetzen. Es gab noch keine klassische Arbeitsteilung, sondern nur eine Arbeitsaufteilung nach dem Mobilitätspotenzial der einzelnen Personen und gegebenenfalls einige Spezialisten. Alte, Schwangere und stillende Weiber hatten ein geringeres Mobilitätspotenzial als erwachsene Männer und Weiber ohne „Kindbelastung“. In diesem Rahmen konnten sich auch gewisse Spezialisierungen herausbilden, die auf Schwerpunkttätigkeiten bestimmter Personen bzw. Personenkreise aufbauten. Auf diese Weise wurde der „qualitätsbestimmende“ Auf- und Ausbau des Grubenhauses eine Angelegenheit der „wenigermobilen“ Weiber und Alten und die Logistik der Beschaffung/Heranschaffung notwendiger und zweckentsprechender Baumaterialien eine Aufgabe der „mobileren“ Männer und Jugendlichen.
Jeder Mensch machte seine benötigten Werkzeuge selbst – er wusste aus Erfahrung, wie das Werkzeug gestaltet werden musste, damit er damit seine Arbeit so gut wie möglich ausführen konnte. Ein Jäger bzw. eine Jägerin fertigte die Steinspitzen für ihr Jagdwerkzeug, wer ein Schneidinstrument brauchte, stellte es für seine Bedürfnisse selbst her. Kein Weib wird zu „ihrem“ Mann gesagt haben: „Ach, mein lieber Mann, mach mir mal ein neues Messer – mein altes ist kaputtgegangen.“ Es kam aber sicher vor, dass die Gemeinschaft einige kundige Mitglieder „abdelegierte“, um neues Feuersteinmaterial für die allgemeine Werkzeugherstellung in der Gemeinschaft heranzuschaffen (Beschaffungsexpeditionen), wenn nicht gar eine ganze Gruppe im Rahmen ihrer Wanderzüge zu einer solchen Ressource zog und dort ihren Materialbedarf befriedigte.
Die Übergangszeit von Basketmaker II zu Basketmaker III (400 bis 500 u.Z.)
Die zeitliche „Grenze“ (besser Übergangszone) zwischen dem verbreiteten Korbgefäß und dem Beginn der Herstellung von keramischen Gefäßen gilt, etwas sehr „schwarz-weiß“ gezeichnet, als der Übergang von der nomadischen SammlerIn-/JägerIn-Gemeinschaft zur sesshaften Bodenbauergemeinschaft. Die bei 700° bis 800°C im offenen Feuer gebrannten weichkeramischen Gefäße waren auf Grund ihrer technischen Eigenschaften (geringe Härte, geringe Schlagfestigkeit, hohe Bruchempfindlichkeit, hohe Porosität, Gewicht) für die nomadische Mobilität weitgehend ungeeignet und gelten deshalb als Marker für eine Sesshaftigkeit, genauer gesagt: diese Gefäße wurden nicht auf allgemeine Wanderungen mitgenommen, höchstens mal als Geschenk unter Weibern bei einem geplanten Treffen mit benachbarten Gruppen.
Was sich hier scheinbar so klar mit wenigen Worten als Schwarz-Weiß-Darstellung andeuten lässt, waren in Wirklichkeit sich in einer erkenntnistheoretischen zeitlichen Grauzone bewegende und den Archäologen sehr unterschiedlich erscheinende Menschengemeinschaften. Die Menschen dieser Gegend waren auch nach dieser „Grenze“ noch sehr mobil/nomadisch; sie fertigten auch nach dieser „Grenze“ noch Körbe (und Beutel) an; sie lebten auch nach dieser „Grenze“ in vorher typischen Grubenhäusern. Trotz der Angabe dieser „Grenze“ um ca. 450/500 u.Z. (Ende der Basketmaker II Zeit und Beginn der Basketmaker III Zeit) darf man also eine solche schön klare Zahlenangabe nicht als Dogma auffassen. Sie gibt nur als eine ungefähre zeitliche Orientierung.
Die Zeit zwischen 400 und 500 u.Z. wird von den Archäologen als Späte Basketmaker II Zeit bezeichnet und markiert nicht schlechthin einen Übergang zur Basketmaker III Zeit (500 bis 700/750 u.Z.), sondern ist auch in praxi eine Zeit, in der, außer der Entwicklung der Grubenhäuser, auch etliche technisch-technologische Neuerungen erscheinen - die Einführung von Pfeil und Bogen und der Beginn der Herstellung von Keramik. Oft wird dafür der Begriff „Technische Revolution“ benutzt, aber man sollte diese Revolution zurückhaltend interpretieren und entsprechend relativieren - nämlich unter Bezug auf deren Auswirkung auf das reale Leben und auf die Subsistenzwirtschaft.
Читать дальше