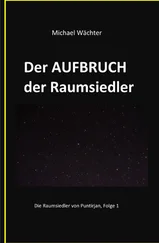Warum war nur dieser Bastard nicht gestorben, überlegte Jack, als er sein Haus betrat. Er bemühte sich, gerade zu gehen, doch seine Beine fühlten sich an wie Blei. Schnurstracks steuerte er auf die große Couch im Wohnzimmer zu und ließ sich wie ein nasser Sack darauffallen. Er blickte auf das neueste Familienfoto, das vor einem Jahr gemacht worden war. Die Welt schien darauf noch in Ordnung zu sein, aber es hatte damals schon gekriselt. Am meisten vermisste er seine Tochter. Ihr Lächeln war einfach zauberhaft.
Jack versuchte sich wachzuhalten. Er hoffte auf einen Anruf von Jessica. In seinen Ohren rauschte es. Er fiel in einen tiefen Schlaf und begann zu träumen.
„Bleib, wo du bist, Dennis!“, schrie er.
Er sah das tote Mädchen neben sich stehen, im Hintergrund ein Meer aus Flammen.
Sie lächelte Jack an, genau wie seine kleine Tochter es immer tat. Ihre Haut war völlig verbrannt, ihr Gesicht voller Brandblasen. Ihre Kopfhaut war schwarz und blutig. Hautfetzen mit Resten von Haaren hingen an ihr herunter. Jack konnte ihr verbranntes Fleisch riechen.
„Dennis ist dort drüben“, sagte sie zu ihm. „Er wollte dir helfen.“ Dann kicherte sie und lief zurück ins Flammenmeer.
„Warte!“, flehte er. „Bitte!“
Dann stieß er einen gequälten Schrei aus und erwachte aus seinem Albtraum.
Das Telefon auf dem Boden klingelte. Benommen nahm Jack den Hörer ab. „Miller.“
„Ich bin es“, sagte eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung.
„Jessica! Wie geht es euch?“ Er schielte auf seine Digitaluhr. Es war inzwischen nach zehn. Vorsichtig richtete er sich auf und versuchte, den Schlaf abzuschütteln.
„Uns geht es gut“, sagte sie. „Kristin hat dich sehr lieb, sie schläft schon tief und fest.“
„Ich habe sie auch lieb, sag ihr das bitte. Wann kommt ihr wieder zu mir zurück?“
Es wurde still, er hörte Jessica tief durchatmen. „Jack“, fing sie an, „ich liebe dich, das musst du mir glauben. Trotzdem brauche ich Abstand. Es war alles zu viel für mich. Dein Job, dieses Unglück, deine Launen und unsere Streitereien. Ich halte es für besser, wenn wir bis auf Weiteres getrennt leben.“
Ein fassungsloses Stöhnen drang über Jacks Lippen. „Warum tust du mir das an, Jessica? Ich habe drei Kollegen und ein kleines Mädchen verloren. Dass es zurzeit nicht einfach ist, weiß ich, aber …“
„Jack“, unterbrach ihn Jessica, „es ist nicht nur der schlimme Einsatz, es stimmt vieles andere auch nicht mehr. Lass uns erst einmal zu uns selbst finden. Mir tut es sehr gut, und ich denke, dir wird es ähnlich gehen.“
„Und was soll ich deiner Meinung nach tun, Jessica?“
„Such dir einen anderen Job, Jack. Einen Job, der familienfreundlicher und nicht so gefährlich ist.“
„Ich liebe meinen Job, das weißt du.“
„Ja“, antwortete sie. „Aber du siehst, was er aus unserer Ehe gemacht hat. Pass auf dich auf. Du hörst von mir, versprochen.“
Allmählich verlor er die Geduld. „Warum tust du mir das an?“, schrie er.
Mit voller Wucht warf er den Hörer gegen die Wand, ließ sich zurück auf die Couch fallen und schloss die Augen. Seine Gedanken kreisten immer wieder um seinen Traum und das Telefonat mit Jessica. Dann schlief er wieder ein.
Am nächsten Morgen beschloss Jack, seine Wache zu besuchen. Er brauchte jetzt die Aufmerksamkeit seiner Jungs, um mit den Ereignissen der letzten Wochen fertigzuwerden. Auch wenn er sich am liebsten verkrochen hätte, er war niemand, der vor einem Problem davonlief. Er war ein Kämpfer, ein Stehaufmännchen.
„Ich schaffe das alles“, sagte er zu sich selbst, während er in die 15. Straße von West Oregon einbog. Seine Wache war ein mehrstöckiges Gebäude mit sechs Fahrzeugtoren, das in den letzten zwei Jahren rundum saniert worden war. Das Gebäude war zwar alt, machte aber einen sehr gepflegten Eindruck. Sein oberster Boss, Oscar Stevens, hatte schon immer hohen Wert auf Disziplin gelegt. Sie hassten ihn für seine krankhafte Strenge, aber sie wussten auch, dass es ohne Disziplin in ihrem Job nicht ging. Einer musste sich durchsetzen und in diesem Männerhaufen für Ordnung sorgen.
Jack dachte an Stevens Worte: „Wie Sie zu Hause leben, ist mir egal, aber hier leben Sie nach den Regeln der Feuerwehr von Oregon. Bis zum Tod oder bis zur Rente. Haben Sie mich verstanden?“
Jack konnte noch heute seinen strengen und versteinerten Blick spüren. Es war damals eine harte, aber auch verdammt gute Ausbildung gewesen. Zu Stevens hatte Jack ein sehr gutes Verhältnis, es war sogar fast freundschaftlich. Aber sein Respekt vor ihm war immer noch genauso groß wie damals. Auch wenn er von seinem Boss in dieser schweren Phase unterstützt wurde, er ihn bat, wieder seinen Dienst aufzunehmen, ihm sagte, dass er absolut keinen Fehler gemacht habe. Jack war es egal, er war am Tiefpunkt seines Lebens angekommen und gab sich eine Mitschuld am Tod seiner Kollegen. Hätte er Dennis mitgenommen, hätten die anderen Kollegen ihn nicht suchen müssen. Jack hasste sich für seine Entscheidung in dieser Nacht, doch er war entschlossen, die Zeit durchzustehen. Er hatte es einfach noch nicht verarbeitet und weigerte sich, in ein Feuerwehrfahrzeug zu steigen, um das zu tun, was ihn immer stolz gemacht hatte: versuchen, anderen Menschen das Leben zu retten.
Heute wollte er auf seine innere Stimme hören, und er dachte erneut über das gestrige Gespräch mit Jessica nach. Mit langsamen Schritten betrat er die Wache durch ein offen stehendes Rolltor. Es war sein zweites Wohnzimmer, die Leute hier waren seine zweite Familie.
Jack nahm einen tiefen Atemzug. Er liebte den Geruch von Benzin, Schweiß und Ruß, der in der Fahrzeughalle lag. Es war kein penetranter oder ekeliger Geruch, aber man wusste sofort, wo man sich befand: in der Fahrzeughalle der städtischen Berufsfeuerwehr von Oregon.
Marc, der gerade dabei war, ein Fahrzeug zu polieren, blickte verwundert in Jacks Richtung. „Also wenn das nicht …“ Er wandte sich Jack zu und grinste freudestrahlend.
„Wenn man vom Teufel spricht …“, sagte eine andere Stimme.
Jack drehte sich zur anderen Seite um. Es war sein Chef. Er schien seit dem letzten Einsatz um Jahre gealtert zu sein und sah mitgenommen aus.
„Wie geht es dir?“, fragte er Jack.
„Es geht, aber es fällt mir immer noch sehr schwer zu glauben, was passiert ist.“
„Kann ich verstehen. Auch mir geht es schlecht, Jack. Aber uns trifft keine Schuld. Wir wussten von Gasflaschen, aber nicht von dem hochexplosiven Ethin. Es war ein Unfall. Dennis hatten wir gefunden. Er lebte und hatte sogar noch Luft zum Atmen. Wir sollten uns nicht die Schuld geben. Wir haben versucht, ein Kind zu retten und einen Kollegen zu finden, der sich scheinbar verirrt hatte.“
Jack nickte ihm zu. „Warum hat er nicht auf mich gehört, Chef? Er sollte warten, es waren keine fünf Meter zwischen uns.“
Sein Chef legte den Arm um ihn. „Vielleicht hat er ja etwas gehört und wollte nachsehen, was es war. Du weißt, wie es ist, wenn man jung ist. Man möchte seinen Kollegen zeigen, dass man es im Einsatz draufhat. Wer weiß, ich würde diesem Bengel sogar zutrauen, dass er das Zischen des ausströmenden Gases gehört hat. Er wollte nachsehen und hat sich dabei verlaufen. Jugendlicher Leichtsinn, vielleicht war er einfach zu übermütig.“
„Das war jeder von uns schon mal im Einsatz“, stimmte ihm Marc zu.
„Ihr habt vielleicht recht“, antwortete Jack zögernd.
Und sein Chef ergänzte: „Nur ist es bei uns damals gut gegangen.“
Jack nickte, gab sich aber mit den tröstenden Argumenten seiner beiden Kollegen nicht zufrieden. „Ich brauche trotzdem erst einmal Abstand. Vielleicht sollte ich mich für ein paar Monate versetzen lassen.“
„Jack, verdammt, wir brauchen dich hier. Es war nicht deine Schuld. Schau mich an. Glaubst du, ich mache mir keine Vorwürfe? Immerhin habe ich euch da reingeschickt.“
Читать дальше