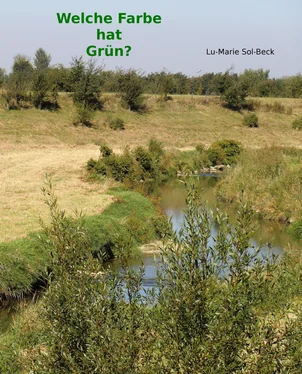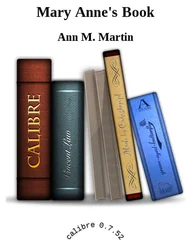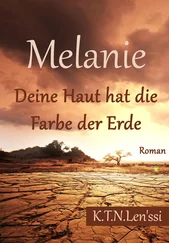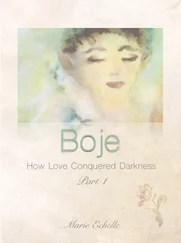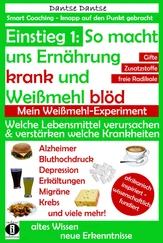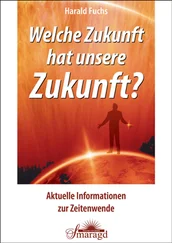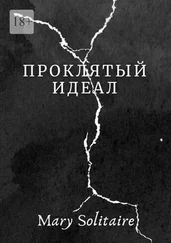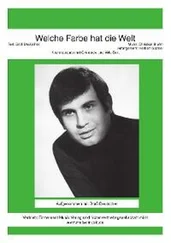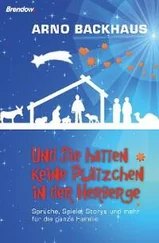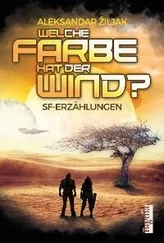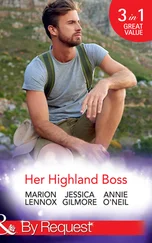L.-M. bewegt sich in gebückter Haltung unter dem Quittenbaum, denn die Äste hängen tief, tragen schwer an den Früchten. Mitten am geschotterten Weg entdeckt die Frau ein Wühlmausloch. Jetzt weiß sie auch, wer für das Verschwinden ihrer geliebten Tulpen (Tulipa) verantwortlich ist. Einmal hatte sie schon diese Missetäterin im Verdacht gehabt, denn sie hatte eines Tages im Frühling fassungslos zusehen müssen, wie eine prächtige, rot blühende Tulpe tiefer und tiefer im Boden versunken war. Sie erinnert sich, dass sie einmal gelesen hat, Tulpenzwiebeln seien in früheren Zeiten eine Delikatesse für reiche Menschen gewesen. Die exaltierte Maus wird sich schamlos reich fühlen in diesem Beet (fürchtet L.-M.), während diese Dekadente ohne Skrupel die Gärtnerin arm frisst. Im Herbst müssten schon wieder neue Zwiebeln besorgt und gesetzt werden. Oh, der Frühling in Niederösterreich und in Oberösterreich oder in Nelkendorf! Den sollte man einmal erlebt haben! An allen diesen Orten hat L.-M. ihn schon genossen.
Das größte Bundesland Österrreichs mit dem Namen Niederösterreich bestellt (augenscheinlich) jedes Jahr höchstpersönlich den Frühling pünktlich für den ersten Märztag, denn er stellt sich alljährlich in den Farben des Landes ein: in Gelb und in Blau.
Zwei Wochen davor mag es noch bitterkalt gewesen sein, mit Temperaturen von minus zehn bis minus zwölf Grad. Doch nur eine Woche danach weicht schon die „sibirische“ Kälte einer erträglicheren, sodass unmittelbar neben den schmutzigen Schneeresten die ersten Schneeglöckchen schneeweiß durchbrechen können in der festen Absicht, der kommenden, warmen Zeit Blumen zu streuen. Als Kämpfer gegen kühle Widrigkeiten stechen bei jeder Blüte drei spitze, lange Blütenstilette in den Himmel, schützen dabei die drei viel kürzeren, sich schützend als enges Röckchen um die Staubgefäße legenden, die mit ihrem grünen Rand tatsächlich einem Röckchen näher kommen als Blütenblättern.
Kaum erreicht das Thermometer zwölf Grad oder mehr, da drängen schon die sanft-gelben (seltener auch rosa getönten oder royal-blaue)n Knospen der Wiesenprimeln als erste aus den flach am Boden liegenden sattgrünen, ausgeprägt gerippten Blattnestern – ganze Wiesen leuchten plötzlich zart hellgelb – alle Augen wenden sich ihnen zu, die Seelen dürsten nach Licht, eine unbestimmte Hoffnung keimt in ihnen, und Freude erfüllt die Menschen beim Anblick der Sonnenfarben. In den folgenden Tagen strecken sich fünf bis sechs an den Kuppen eingedellte, hellgelbe Blütenfinger sonnenhungrig der lange vermissten Wärme entgegen, bieten in ihrer Mitte den klar gezeichneten Kelch den Insekten an, voll gefüllt mit süßem Nektar, bleiben aber geduckt - dem Schönwetter misstrauend - nah am Boden. Ihnen folgen – buchstäblich auf dem Fuße, weil ebenso geduckt – die Ranken des himmelblauen Immergrüns.
Bis zur Mitte des Monats harren die großen Schwestern aus, die Narzissen, blinzeln derweil ein wenig durch die hauchdünnen, grünen Knospenhäutchen mit ein bisschen Gelb an den Spitzen in den Frühlingstag, um nach zu schauen, ob denn ihre Zeit nicht auch schon gekommen wäre. Dann aber öffnen sich alle innerhalb von zwei bis drei Tagen. Schwer wippen die kräftig-gelben oder orangen Röhren, welche die Staubgefäße umrahmen, umrundet von fünf darüber schwebenden Volants im selben Ton. Tage später würden sich ihre weißen Verwandten bei ihnen einfinden, ein bis zwei Wochen später ihre Cousinen, die wohlriechenden Dichternarzissen. Sie alle erinnern an Satelliten, oder wurden vielleicht die Satelliten nach dem Vorbild der Märzenbecher (wie man sie im Lande auch gerne nennt) gebaut? Wochenlang stehen diese Frühlingsboten unverdrossen geöffnet da oder werden von den Winden geschaukelt.
So selten das Blau in der Blumenwelt normalerweise zu finden ist, im Frühling leuchtet es üppig und kräftig aus den lichten Wäldern des ganzen Landes – in der Gestalt der Leberblümchen – die im Verblühen verblassen – und ebenso üppig spiegelt sich der Himmel hier unten in Gestalt der duftenden, blauen, violetten, lilafarbenen oder weißen Veilchen (Viola). Ihre Köpfchen unterscheiden sich von „normalen“ Blüten – und das hat einen ganz besonderen Grund.
Die Sage geht – so eine Erzählung der Urgroßmutter Franka, dass die Sippe der Veilchen einst aus dreierlei Gründen quasi „vom Wege abkam“ und dafür mit Konsequenzen zu rechnen hatte: erstens wegen der wertvollen Wurzeln, an denen Säuglinge während des Zahnens kauen, zweitens wegen ihres unvergleichlichen Duftes , welchen die weiblichen Menschen-Wesen bevorzugen, um ihren eigenen Geruch zu übertünchen, und drittens wegen der kräftig violetten Färbung, die in den uralten Zeiten keine andere Pflanze der Erde vorzuweisen hatte. So gesegnet, wurden die Violetten von den Zweibeinern, den Bleichen, den Schwitzenden, denen es an all dem mangelte, wovon die Veilchen im Überfluss haben, so sehr geliebt und verehrt, dass die Herrlichen dem Hochmut verfielen. Gewöhnliche Insekten sollten nicht beliebig ihren Nektar kosten dürfen, oh nein. Das suchten sie zu verhindern, indem sie ihre Blättchen unnatürlich verbogen, sie über den wertvollen Schatz schoben. Das wurde der Erdenmutter Gaia zugetragen. Entrüstet blickte sie auf ihre überreich beschenkten Kinder, griff wütend mitten hinein in die Gemeinschaft der Eitlen, um sie mit Stumpf und Stiel auszureißen. Doch wie wehe tat ihr das im selben Augenblick, zu sehr war sie Mutter. So ließ sie ab von ihrem Tun und wandte den Blick verstärkt den anderen Kindern zu, konnte aber nicht umhin, täglich nach ihren bestraften, aber trotz allem geliebten Kindern zu schielen und auf deren Einsicht zu hoffen.
Nachdem sich der große Sturm gelegt hatte, stellten die Violetten fest, dass ihnen ihre Schönheit quasi ausgerissen worden war, dass ihnen nur noch fünf „Fingerchen“ gelassen worden waren, die unschön verteilt um die Staubgefäße flatterten. Zwei Blütenblättchen ragten in die Höhe, drei wiesen zu Boden. Fünf Blättchen - das war nicht mehr und nicht weniger, als unzählige andere Blumen ihr Eigen nennen, überlegten die Beschämten. Und jenen, die von der strafenden Hand unmittelbar berührt worden waren, denen war unglücklicherweise die Farbe abhanden gekommen, „bleich vor Angst“, so sagt man bis heute. Diese Unglücklichen blieben in hellen Lila und rosa Tönungen oder in einem cremigen Weiß bescheiden zurück. Traurig lässt das Volk der Veilchen seitdem die Köpfchen hängen.
Wie zum Hohn erhoben sich unweit von ihnen die kräftigen, blauen Hyazinthen, und ausgerechnet dieses Spargelkraut sollte die Veilchen in jeder Hinsicht übertreffen, an Höhe, an Blütenfülle und an Duft. Sie, die bis dahin bescheiden ihr Dasein gefristet hatten, sie sollten fortan als erhobener Zeigefinger der Erdenmutter fungieren.
Die Veilchen hatten verstanden. Beschämt zogen sie sich zurück - unter die Büsche, an die lichten Plätze unter den Bäumen, an die noch freien Ränder an den Hecken, dorthin, wo sie niemanden stören könnten. Fortan sollten sie nur für eine kurze Zeit blühen, hatten ihre Blüten für immer neu modelliert – wie gesagt, zwei Blütenblätter weisen nach oben, drei in einem sanften Schwung nach unten. Wie geöffnete Schnäbelchen sehen sie aus und bleiben für alle Insekten einladend weit geöffnet, gleichen geradezu kleinen Landeplätzen. Im restlichen Jahr, wenn die Samen reifen, lassen die „Zurechtgestutzten“ grüne Blätter in einer perfekten Herzform stehen – ein Zeichen der Liebe, gerichtet an die Gute Erdenmutter allein.
Die blauen, gelben, hellvioletten und weißen Krokusse, welche die Waldränder früh im Jahr zieren, wurden von den Duftenden noch nie als Konkurrenten betrachtet. Das lässt die Krokusse ohnehin sozusagen kalt. Souvären blühen sie, ohne sich nach den anderen zu richten. Sie sind stets die ersten Färbigen, die durch die noch kühle Erde brechen, oft sogar durch den Schnee. Die Menschen holen sich viele von ihnen in ihre Gärten, weil sie so schön leuchten, weil ihre Farben so kräftig sind in ihrer Buntheit als wären sie lebendige Diamanten.
Читать дальше