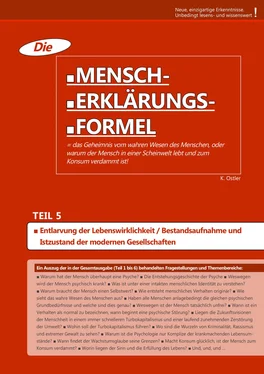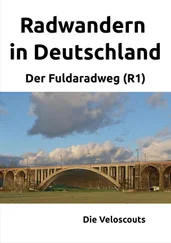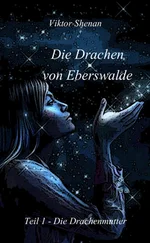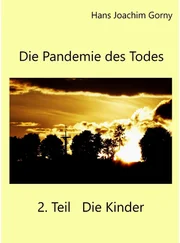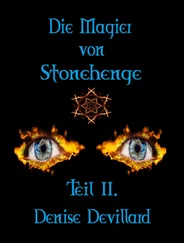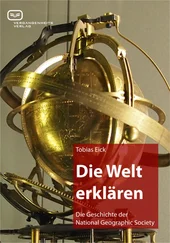Aktuell setzen die Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie an den üblichen Hebeln, Koordinaten und Grenzen der vorgegebenen Lebenswirklichkeit an, gliedern sich in das Gesamtgeschehen ein und werden so zum Teil des Systems. Die Psychologie degradiert sich zum Werkzeug der tatsächlichen Lebenswirklichkeit wie zum Handlager des Systems und versucht lediglich innerhalb dieser Gegebenheiten den Menschen funktionstüchtig (ähnlich dem Arzt für den physischen Bereich) zu machen bzw. die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, als mit Vehemenz, Nachdruck und Ausdauer darauf hinzuweisen, dass die Lebensumstände seinen Ur-Bedürfnissen nicht entsprechen und ihn deshalb zwangsläufig krank machen.
Die Psychologie muss sich wegen ihrer Erkenntnisse über die elementare Veranlagung des Menschen, dessen psychischer Struktur und deren sich bedingenden Kausalitäten nach vorwärts gerichtet positionieren und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verlangen, die den genannten Präventivcharakter berücksichtigen.
Psychologie muss so eine vollkommen andere gesellschaftspolitische und soziale Relevanz und Wertigkeit erhalten, als sie gegenwärtig einnimmt und diese gleichfalls beanspruchen.
Drastisch und auf den ersten Blick (vielleicht) übertrieben formuliert, prostituiert sich heute die Psychologie in einigen Gebieten und ist sowohl Komplize wie Profiteur der existierenden Zustände. Der Nachschub an psychisch erheblich gestörten Menschen reißt nicht nur nicht ab, sondern wird mitunter selbst generiert.
Beispielhaft sei hier das Wirken von Wirtschaftspsychologen erwähnt, die ihr Wissen gezielt dafür einsetzen, Produkte und Dienstleistungen zu konzipieren und zu kreieren (und anschließend passende Werbekampagnen und Vermarktungsstrategien zu arrangieren), deren Eigenschaften punktgenau an den psychischen Schwachpunkten des Menschen, hauptsächlich an seinem Bedarf an Ersatzbefriedigung anhand von Ersatz- und Kompensationshandlungen, ansetzen. Dadurch werden entweder neue Abhängigkeiten geschaffen oder bestehende weiter ausgebaut wie gleichzeitig manifestiert und dies zu guter Letzt darüber hinaus noch zur Profitmaximierung ausgenutzt.
Wenn beim Verbraucher massive Kaufwünsche ausgelöst werden und per übermäßigen Konsum bzw. starker Konsumorientierung folglich – um bloß ein kleines Spektrum potenzieller Auswirkungen zu nennen - Kaufsucht, Frustrationen (angesichts dem geringen und nicht nachhaltigen Befriedigungswert; sobald Kauflust nicht realisiert werden kann und daher am Konsum nicht teilgenommen werden kann), Burn-out-Syndrom (ausgesprochene Leistungsausrichtung, um den Konsum bezahlen und mit anderen Menschen im Vergleich mithalten zu können) oder finanzielle Probleme entstehen, dann ist der Psycho-/Verhaltenstherapeut zur Stelle, der die mithilfe der Psychologie zumindest geförderten Probleme wieder beseitigen soll.
Fazit: Psychologie ist keine (austauschbare) Dienstleistung wie viele weitere, sondern muss Ausgangspunkt und zugleich Triebfeder für die Umkehr und Rückbesinnung auf die ursächlichen, essenziellen und (gleichwertig) nicht ersetzbaren Bedürfnisse des Menschen sein, anstatt wie bislang bestenfalls schon präsente oder bereits abgeschlossene Entwicklungen zu analysieren und zu kritisieren. Unabdingbar hierfür ist ein geweiteter Blick über den eigenen Fachbereich hinaus, der die gesellschaftlichen Zusammenhänge, Kausalitäten und Abhängigkeiten in Bezug zu den menschlichen Problemfeldern in angemessener Form und im nötigen Umfang berücksichtigt und diese schließlich mit Entschiedenheit im gesellschaftlichen Diskurs vertritt.
Das psychologische Wissen über den Menschen darf nicht zu seinen Lasten benutzt (Bereich Wirtschaft) oder als „Waffe“ gegen ihn verwendet bzw. missbraucht werden – hier ist vor allem die Politik mit ihren Wahlstrategen gemeint, die mit ihren psychologischen Kenntnissen bewusst Ängste schüren und diese bedienen –, um sich damit an seiner identitätsgemäßen Grundproblematik bereichern zu können, ob in Form von wirtschaftlichem Profit oder/und mittels Machtgewinn/-erhalt.
Die gegenwärtigen Klassifikationen der Psychiatrie müssen überdacht und modifiziert werden, da beim vorhandenen Status quo die Definition, wann eine psychische Krankheit beginnt bzw. diagnostizierbar ist, bei Weitem zu beschränkt ist, mit der Konsequenz, dass viele Problem erzeugende Verhältnisse und Einstellungen (Verhältnisse und Einstellungen, die zu psychischen Defiziten und Störungen führen), als normal angesehen werden.
Zur Verdeutlichung ein aktuelles Beispiel: Ein bekannter und renommierter, auch als Gutachter tätiger Psychiater hat auf die Frage, was die brutal mordenden und sich dabei filmenden IS-Terroristen antreibt und ob sie als psychisch krank zu bezeichnen sind, geantwortet, dass nach den gängigen Klassifikationssystemen der Medizin bei diesen Terroristen keine psychische Krankheit vorliegt. Unter anderem wurde diese Auffassung mit dem Verweis auf Studien und Gutachten über die Attentäter vom 11. 9. 2001 in Amerika begründet, bei denen festgestellt wurde, dass von mehr als zwanzig Angeklagten nur einer tatsächlich an einer Psychose erkrankt gewesen sei, und bei zwei weiteren konnte lediglich eine psychische Krankheit vermutet werden.
Weiter wurde ausgeführt, dass in der Psychiatrie zwischen Wahn und Fanatismus unterschieden wird, mit dem Ergebnis, dass Wahn eine psychische Krankheit ist, Fanatismus jedoch nicht.
Dass hier ein großer, durchaus gefährlicher Irrglaube besteht, wurde schon an vielen Stellen dezidiert beschrieben, denn welche psychische Verfassung sollte sich hinter einer derart fanatischen Haltung befinden …, eine gesunde jedenfalls mit Sicherheit nicht. Die in der Psychiatrie präsenten respektive geltenden Einordnungen und Befunde, die zahlreiche, sowohl den Betroffenen wie die Gesellschaft belastende, Verhaltensformen als normal oder zumindest nicht als psychisch krank bewertet, dürfen nicht als sakrosankt erachtet und wie eine „heilige Kuh“ verteidigt werden (Stichwort: Elfenbeinturm-Attitüde). Hingegen müssen diese Einteilungen in ihren Auslegungen – und dies bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf das aufgeführte Beispiel „Wahn und Fanatismus“ - wesentlich geweitet werden, um dadurch die zugrunde liegenden, Problem verursachenden Faktoren (hauptsächlich mangelhafte Grundbedürfniserfüllungen in der Kindheit, die eine instabile, von äußeren Einflüssen abhängige Psyche ergeben) zu erkennen und so überhaupt den Ansatz zur Veränderung an der Ursache, und nicht allein am Symptom, zu ermöglichen.
Sanktionierung und Resozialisierung
Was soll über eine Sanktionierung von kriminellen Handlungen und Gewalttaten durch den Staat erreicht werden (Absicht) und wie sieht das Ergebnis tatsächlich aus (Realität)? Ist die Art der Bestrafung und der Resozialisierung wirklich zielführend oder ist der praktizierte Ansatz falsch respektive ungenügend?
Eine Bestrafung soll mehrere bewusste, aber auch unbewusste Funktionen erfüllen.
Der Staat will und muss seinen Bürgern Schutz bieten (Schutzauftrag) und einen normengemäßen Ordnungsrahmen vorgeben, der unter anderem kraft Sanktionierungen durchgesetzt wird. Er muss über die Gesetze und deren Einhaltung dem Bürger Sicherheit vermitteln, Orientierung verschaffen (Stichwort: der Staat als identitätsfördernder Faktor) und sendet auf diese Weise überdies ein Signal der Abschreckung.
Eine Bestrafung für nicht rechtmäßiges Handeln impliziert indes zudem eine – stillschweigende und automatische – Anerkennung und Bestätigung für das richtige Handeln des „normalen“ Bürgers (ist ein identitätsunterstützender Aspekt) und hat dergestalt, wie die Abschreckung ebenfalls, einen systemstabilisierenden Charakter.
Über eine Bestrafung soll nicht allein indirekt dem Opfer Genugtuung (was immer dies letztlich genau ist …) widerfahren und der Machtanspruch des Staates dokumentiert und eingefordert, hingegen genauso Schuld zurechenbar und damit Verantwortlichkeit begrenzt werden. Die Bestrafung belastet ergo den Täter, Kriminellen und ungesetzlich Handelnden – wie dieser im Übrigen benannt werden soll – mit Schuld und entlastet folglich zwangsläufig alle weiteren Gesellschaftsmitglieder von Mitschuld.
Читать дальше