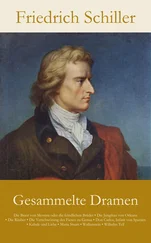Er wollte schon die Suche aufgeben, als er leises Gemurmel hörte. Es kam von irgendwo hinter dichtem Dornengestrüpp her und verlor sich fast im leichten Wind, der am Morgen aufgekommen, unten am Waldboden jedoch kaum zu spüren war. Rimon kroch durch das Gestrüpp und musste immer wieder schmerzhaften Kontakt mit den dornenbewehrten Ästen machen. Auf der anderen Seite fiel das Gelände leicht ab, um wenige Meter später wieder anzusteigen. Der Anstieg war nur mit wenigen Bäumen bewachsen, stattdessen wuchsen viele Sträucher eng an eng und schienen niemanden durchlassen zu wollen.
Unterhalb dieses Gestrüpps kniete jemand am Boden. Es musste ein Mensch sein. Aber Rimon war sich nicht sicher. Es könnte genauso gut auch ein Gobblin oder ein anderes Wesen sein. Es hatte braune Lederhosen an, die abgenutzt und von Wind und Wetter gegerbt waren. Darunter waren leichte Stiefel aus feinem, aber ebenso abgenutztem Leder zu entdecken. Die Person trug einen weiten grün-gräulichen Mantel aus grobem Stoff, der sie beinahe ganz bedeckte. Mehr konnte Rimon nicht entdecken. Das Wesen reckte ihm sein Hinterteil entgegen, und der Kopf war verschwunden. Er steckte bis zu den Schultern in einem Loch, das dort, unterhalb der dichten Sträucher, in den Boden gegraben war.
Leise und undeutlich hörte man den Mann oder das Wesen oder was auch immer es war flüstern. Rimon wollte näher herankriechen, doch er wusste, dass er dann die schützende Deckung des Gebüsches verlassen würde.
Angestrengt versuchte er, die Laute zu verstehen, doch der Wind wehte sie davon, so dass er sie nicht fassen konnte. Was ging hier in diesem dunklen, dichten Wald nur vor? Vorsichtig kroch Rimon etwas auf dem feucht riechenden, moosigen Boden nach vorne. Eine Dorne verhakte sich dabei in seinem Unterarm, woraufhin seinen Lippen ein leiser Schmerzensschrei entfuhr, den er jedoch sofort unterdrückte. Doch das Wesen in dem Loch schien etwas gehört zu haben. Das Gemurmel brach ab und die Person schnellte aus dem Erdloch heraus. Rimon presste sein Gesicht in die feuchte, kühle Erde. Wie erstarrt lag er in seinem Versteck und wagte nicht, sich zu rühren. Kein Glied bewegte er. Sein Atem ging flach. Er schmeckte Erdkrümel zwischen seinen Lippen. Wenn das Erdlochwesen in meiner Richtung sucht, so bin ich verloren. Ich habe keine Chance, schoss es ihm durch den Kopf. Doch der Körper blieb starr, ließ ihm keine Möglichkeit zur Flucht. Wohl wäre dies auch nicht von Vorteil gewesen, hätte er doch mit jeder Bewegung die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So lag er flach gepresst auf der Erde, er wusste nicht, wie lange. Irgendwann, nachdem niemand nach ihm zu suchen schien, hob Rimon langsam wieder den Kopf – vorsichtig – Zentimeter um Zentimeter. Als er den Kopf so weit gehoben hatte, dass er das Erdloch wieder im Blick hatte, atmete er erleichtert auf. Das Wesen hatte den Kopf wieder in das Erdloch gesteckt. Auch das Gemurmel war wieder hörbar. Kurz überlegte Rimon, ob er die Möglichkeit nutzen sollte und mit gezücktem Dolch auf das Loch zupreschen und das Wesen aus diesem herausziehen sollte. Doch im selben Moment verbannte er diesen Gedanken aus seinem Kopf. Nichts und niemand hätte ihn dazu bewegen können, sich dieser Gefahr zu stellen. Töricht wäre er gewesen, sein Schicksal in einem Kampf mit einem Wesen zu suchen, bei dem er nicht einmal wusste, ob es überhaupt ein Mensch war. Wer wusste schon, welche Gestalten sich hier in diesem Wald herumtrieben.
Langsam kroch Rimon zurück, ließ das Gebüsch hinter sich, sprang auf dem Rückweg von Stein zu Stein, um keine Spuren in der weichen Erde zu hinterlassen und kam rasch und sicher in sein Lager zurück.
Hier fühlte er sich wieder sicher. Die Blicke, die ihm gefolgt waren, spürte er nicht.
* * * * *
Rimon hatte den ganzen Tag über nur einmal das Lager verlassen, um Beeren zu sammeln. Er hätte jagen können, doch wollte er kein Feuer machen, über dem er das Wild hätte braten müssen. Mehrmals schritt er den Rand der kleinen Lichtung ab, überprüfte jeden Baum und jeden Stein, aber er konnte nirgends Spuren oder etwas anderes Verdächtiges finden. Die meiste Zeit saß er an einen großen Baum gelehnt, dessen dicke Wurzeln weit ausluden. Zwei Wurzeln hatten einen solch perfekten Abstand, dass sich Rimon zwischen sie setzen und sie als Armlehnen benutzen konnte. So saß er an dem mächtigen Baum, der wohl schon hier stand, als das kleine Dorf, in dem er geboren wurde, noch lange nicht existiert hatte. Die Arme hatte er auf den Wurzellehnen ausgestreckt, die Augen halb geschlossen, obwohl er hellwach die Umgebung beobachtete.
Er ließ seine Gedanken schweifen, dachte an die Zeit, die ihm nun bevorstand, dachte an seine Freunde, an Tama, an die Geschehnisse hier im Wald, ja, er dachte sogar an Erdan, den großen und einen Gott, der über alles herrschte, der alles erschaffen hatte, der wusste, was Gut und Böse war. Doch stets wanderten seine Gedanken zurück zu seiner Mutter. War sie wirklich ernsthaft krank? Oder war es nur Kummer? Musste er sich Sorgen machen?
Schließlich schloss er die Augen ganz. Seine Mutter, die weinte, tauchte auf, verschwand, kehrte wieder, dann trat Thors hervor, schob seine Mutter zur Seite und blickte ihn, Rimon, mit strengem Blick in die Augen. So ging es eine Weile. Jarla und Thors tauchten abwechselnd auf, zogen sich wieder zurück, schoben einander weg, so als ob sie um den vordersten Platz in Rimons Gedanken kämpfen wollten. Doch dann, völlig unvermittelt, verblassten sie beide, Vater und Mutter, und zunächst herrschte vollkommene Leere. Schließlich tauchte ein Schatten auf, klein und verschwommen, dann größer und klarer, bis Rimon sie erkannte. Es war Yolanda, das rothaarige Mädchen aus dem heruntergekommenen Haus am Rande des Dorfes. Langsam kam sie Schritt für Schritt näher. Anfangs umhüllte sie ein leichter Nebel, doch je näher sie kam, desto klarer wurde sie. Sie lächelte. Es war nur ein kleines Lächeln, und doch so unschuldig und rein, wie sonst niemand hätte lächeln können. Rimon meinte, einen Duft riechen zu können – den Duft des Frühlings. Frisch, kühl, aber dennoch warm. Wenn Gedanken riechen könnten, dachte Rimon und ein Lächeln legte sich auf sein Gesicht. Mit diesem Lächeln schlummerte er ein.
Die Schritte vieler Füße, die ganz in der Nähe der Lichtung sich ihren Weg durch den Wald bahnten, hörte er schon nicht mehr.
* * * * *
Ein Keuchen riss Rimon aus seinen Träumen. Noch immer hatte er Yolanda vor seinen Augen gehabt. Ihr Lächeln, der Duft, der Frühling. Doch gegen Ende, so glaubte er sich erinnern zu können, hatte sich ein Schatten auf ihr Gesicht gelegt.
Das Keuchen war direkt neben ihm. Was war das? Ein Traum? Ein heftiger Ruck an seiner Schulter brachte ihn zurück in die Wirklichkeit.
„Wach auf, Rimon, wach auf!“ Tamas Stimme klang eindringlich und schrill in seinem Ohr. Erneut schüttelte sie ihren älteren Bruder an der Schulter. Jetzt endlich öffnete er die Augen.
Es war dunkel. Er musste lange geschlafen haben. Seine Schwester kniete neben ihm, ihr Atem ging schnell, Schweiß stand ihr auf der Stirn. Ihre ansonsten so großen und ruhigen Augen waren zu schmalen, ängstlich umherirrenden Schlitzen verengt. Mit einem Male war Rimon hellwach. Er hatte seine Schwester noch nie so erlebt. Sie war stets ruhig. Wenn sie dermaßen aus der Fassung geraten war, musste tatsächlich etwas Schlimmes geschehen sein.
Mutter! Der Gedanke schlug ein wie ein Blitz und lähmte ihn. „Was ist mit Mutter?“ Seine Stimme war brüchig, zitterte. Mit seiner Rechten fasste er Tamas Hand. „Nun sag schon! Was ist mit Mutter?“
„Nichts. Nichts ist mit Mutter!“ Tamas Augen rasten wild hin und her, als suchten sie etwas. „Du musst weg hier! Schnell! Hier auf der Lichtung finden sie dich sofort!“
Rimon verstand überhaupt nichts. „Was? Was ist los? Warum soll ich denn weg?“
Читать дальше