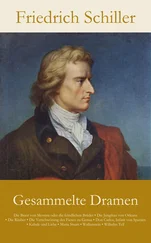Gedanken schossen wie wild durcheinander. Der Schatten hinter dem Baum. Die Spuren. Das Blut auf der Feuerstelle. Der Mann im Erdloch.
„Du musst weg! Bitte! Sie finden dich hier!“ Tama wurde immer unruhiger. Ihre Augen blickten zur anderen Seite der Lichtung, schienen aber nichts zu bemerken.
Rimon umfasste mit seinen Händen Tamas Kopf und versuchte, diesen still zu halten. Nur widerwillig ließ Tama dies zu. Schließlich blickte sie ihm tief in die Augen. Angst, ja, regelrechte Panik flackerte in ihren tiefen, dunklen Augen. Sie holte tief Atem, versuchte, etwas ruhiger zu werden.
„Ich weiß nicht, wie Gobblins aussehen“, sagte sie. „Ich habe nur die vielen Geschichten der Alten und von Vater gehört, wenn sie von ihren Abenteuern und Kämpfen gegen Bersker, Trolle und Gobblins erzählt hatten. Aber nun bin ich mir sicher, dass ich eben hier auf dem Weg zu dir eine Horde Gobblins gesehen habe. Ich wollte dir gerade einen Korb mit Essen bringen. Den habe ich fallen lassen. Als ich diese hässlichen Gnome zwischen den Bäumen entdeckt habe, konnte ich nicht mehr klar denken. Sie kamen direkt auf mich zu. Ich habe den Korb vor Schreck fallen lassen und bin zu dir gerannt. Sie müssen den Korb mit all den Leckereien entdeckt haben und wissen, dass hier jemand im Wald ist!“ Mit den letzten Worten schwoll Tamas Stimme wieder an und klang erneut so schrill wie zu Beginn. Ihre Blicke wanderten am Rand der Lichtung entlang, doch noch immer wirkte alles still. „Nun mach schon, Rimon, schnapp dir Yaris und verschwinde hier! Ich renne zurück ins Dorf und schlage Alarm, dass sich hier Gobblins im Wald herumtreiben. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß mich zu verstecken! Nun mach schon!“
Noch ehe Rimon etwas erwidern konnte, ehe er seine Schwester zum Bleiben aufhalten konnte, war sie bereits zwischen den Bäumen verschwunden. Zunächst wollte er ihr hinterher. Schließlich war er ihr älterer Bruder. Er musste sie beschützen und konnte sie nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen.
Bevor er ihr aber hinterher rennen konnte, lenkte Yaris seine Aufmerksamkeit auf sich. Das Pferd begann zu scheuen, warf unruhig den Kopf hin und her, tänzelte und dann – stieg es, wieherte laut und ängstlich, galoppierte zwischen Bäumen hindurch und verschwand in der Dunkelheit.
„Nein!!! Yaris! Bleib stehen!“ Die verzweifelten Rufe Rimons konnten das Pferd nicht zurückholen. Mit Yaris waren auch der Bogen und sämtliches Gepäck verschwunden. Nur der Dolch, den Rimon an seinem Gürtel trug, blieb ihm. Doch für die Verteidigung gegen eine Horde Gobblins war dies eindeutig zu wenig. Tausende Gedanken schienen gleichzeitig durch den Kopf zu schießen. Panik und ein Gefühl in der Magengrube, das Rimon beinahe erbrechen ließ, machten sich breit. Er war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
Da bemerkte er, wie still es um ihn herum geworden war. Kein Vogel gab mehr einen Laut von sich, kein Rascheln mehr im Unterholz. Die Stille war unheimlich, wollte ihn niederdrücken. Langsam drehte sich Rimon der Lichtung zu, war nicht fähig, aufrecht zu stehen, so sehr drückte die ohrenbetäubende Stille. Doch noch immer schien sich niemand der Lichtung genähert zu haben. Angestrengt suchte Rimon den gegenüberliegenden Rand des Lagerplatzes ab. Nichts. Ein zweites Mal ließ er seinen Blick über die Bäume, Büsche und die Dunkelheit dazwischen wandern. Wieder nichts. Doch da – in einem Busch! Rimons Herz schlug schneller und wollte in seine Hose rutschen. In einem Busch waren zwei Augen. Ja – da waren zwei Augen. Grüne Augen mit einer roten Pupille. Ruhig blickten die roten Punkte zu Rimon. Das Grün war wie Gift. Gift mit einem roten Pfeil in der Mitte, der bereit lag, direkt auf Rimon abgeschossen zu werden. Da entdeckte Rimon zwischen dem Busch und dem danebenstehenden Baum ein weiteres Augenpaar. Auch dieses von giftigem Grün und bedrohlichem Rot. Dann tauchte ein weiteres auf, und noch ein weiteres, und noch eines. Schließlich blickten ihn sechzehn dieser schrecklichen Augen an.
Rimon wusste, dass dies sein Ende war. Bereits nach drei Tagen allein in der Wildnis hatte er den Kampf verloren. Die Finger tasteten nach dem Griff seines Dolches. Es war ein leichtes Gespür von Sicherheit, als er das warme Leder des Griffes fühlte. Er würde seine Haut wenigstens teuer verkaufen.
Doch dann entschied er sich anders, machte kehrt, nahm seine Füße unter die Arme und rannte, wie er noch nie in seinem Leben gerannt war. Hinter ihm erhob sich ein wildes Geschrei – höhnisch, verächtlich und vor allem tödlich. Rimon rannte und rannte. Im Dunkel der Nacht und des Waldes sah er überhaupt nichts. Er stolperte über eine Wurzel, fiel, rappelte sich wieder auf, rannte weiter, stieß sich sein Knie an einem Felsen. Plötzlich prallte er mit voller Wucht gegen einen Baum. Er taumelte. Doch die fürchterlichen, vor Lust und Blutgier quietschenden Stimmen, die sich ihm immer bedrohlicher näherten, trieben ihn weiter. Erneut stolperte er über eine Wurzel, fiel, konnte sich nicht halten, schlug mit der Stirn hart gegen einen Stein am Boden. Noch ehe er das Bewusstsein verlor, spürte er, wie sich eine Hand seinem Mund näherte, diesen zupresste, während eine andere Hand seinen Arm packte und ihn wegzog. Dünne Äste kratzten über sein Gesicht. Dann wurde es Nacht.
Hektisch suchte Yolanda ihre Sachen zusammen. Viel hatte sie eh nicht. Ihre roten Zöpfe hingen schlaff über ihre Schultern. Sie schlüpfte aus dem alten weißen Kleid, welches man an Verbrennungstagen trug. Nackt stand sie vor der hölzernen Truhe, in der sich all ihre wenigen Kleider befanden. Sie war mager geworden während der letzten Monate. Seitdem ihre Mutter krank im Bett gelegen war, hatte sie nicht mehr viel gegessen. Die Beeren im Wald machten nicht satt. Manchmal konnte sie aus den Erkern hinter den Häusern im Dorf, dort wo sich die Vorräte befanden, etwas Brot und ab und zu sogar ein wenig Fleisch stehlen. Doch dies wurde zunehmend gefährlicher, denn die Dorfbewohner argwöhnten bereits und verdächtigten das fremde Mädchen mit der kränklichen Mutter. Wer sollte es auch anders gewesen sein? Nachweisen konnte ihr allerdings niemand etwas. Ein schlechtes Gewissen hatte Yolanda den Dorfbewohnern gegenüber nie gehegt. Sie verachtete die Menschen hier. Weil die Menschen sie und ihre Mutter verachteten. Tagtäglich spürte sie die misstrauischen Blicke, die auf ihr ruhten. Sie sah die Leute tuscheln und hinter vorgehaltener Hand kichern. Bösartig waren die Menschen hier, da war sich Yolanda sicher.
Nur der Junge, der oben auf dem Hügel wohnte, bedachte sie nicht mit einem abschätzigen Blick. Er hatte einen Vater, der früher angeblich ein tapferer Krieger gewesen war. Sie mochte ihn nicht; angewidert ging sie ihrer Wege, wenn der alte Mann sich in seinem Ruhm suhlte und all die anderen, wie von Zauberhand bewegt, andächtig an seinen Lippen hingen.
Yolanda hatte in dem Jungen einen Freund gefunden. Rimon. Ihr Freund. Und wie sie ihn verfluchte, als er ihr mitteilte, dass er sich nicht mit ihr im Dorf blicken lassen dürfe, denn was würden dann sein Vater und seine Freunde dazu sagen. War sie denn solch eine Aussätzige, dass niemand mit ihr auf offener Straße sprechen konnte? Zudem sprach er immer wieder davon, welch großer Reiter und Krieger er werden würde, wenn er erst einmal das sechzehnte Lebensjahr abgeschlossen hätte. So wie es sein Vater von ihm erwartete. Sie verstand ihn nicht. Aber dennoch mochte sie ihn.
Yolanda betrachtete sich in dem alten, milchigen Spiegel, der an der Wand hing. Er war eine der wenigen Kostbarkeiten, die sie besaßen. Ihre Rippen traten deutlich hervor, darunter bildete der Magen eine Kuhle, die auf herausstehenden spitzen Beckenknochen ruhte. Ihre Gesichtszüge hatten etwas Kindliches behalten, während sie allmählich zur Frau wurde. Ihre Brust wuchs und ihre Scham wurde von dichtem Haar bedeckt, welches nicht wie der Schopf auf dem Kopf rot, sondern tiefschwarz war.
Читать дальше