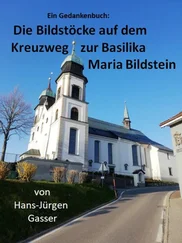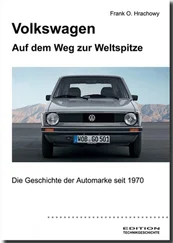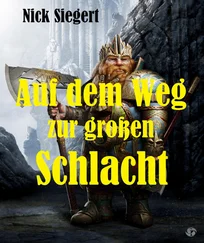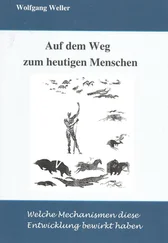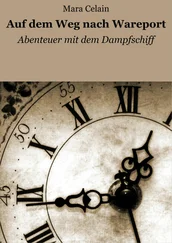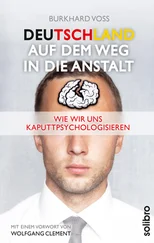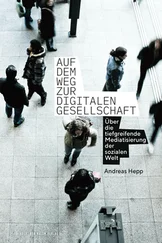Karlheinz Vonderberg - Auf dem Weg zur Göttin - MARIA
Здесь есть возможность читать онлайн «Karlheinz Vonderberg - Auf dem Weg zur Göttin - MARIA» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Auf dem Weg zur Göttin : MARIA
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Auf dem Weg zur Göttin : MARIA: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Auf dem Weg zur Göttin : MARIA»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Auf dem Weg zur Göttin : MARIA — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Auf dem Weg zur Göttin : MARIA», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Gen 1 stellt dem entschuldigend eine Art „intellektuelle Sicht“ gegenüber, in der Mann und Frau gleichberechtigt als Ebenbilder Gottes gesehen werden. Dass diese Sicht schon bei der Abfassung der Priesterschrift sicher nicht der Wirklichkeit der Frauen entsprach, ist wohl klar.
Eine Sache ist aber auch hier auffällig. Der Schöpfer wird mit seinem Wort aktiv, nicht mit irgendeiner Form weiblicher oder männlicher Potenz. Es werde! Und es ward. Das geht so bis zum 6ten Tag, an dem er nicht mit dem Wort schöpferische Aktivität entfaltete. Hier fordert er nicht ein externes Geschehen, wie bei der Aufforderung, Licht, Sonne, Mond, Sterne, Gräser oder Vieh zu gestalten. Er spricht mit sich selbst, fordert sich selbst auf, etwas zu schaffen, was mit ihm eine gewisse Ähnlichkeit hat, nämlich den Menschen in Form von Mann und Frau. Diese Aufforderung an sich selbst (Gott im Plural! Elohim) erfordert Kräfte, die in ihm selbst ruhen, die in dem übrigen Geschehen der externen Welt nicht zur Verfügung stehen. Da er sowohl Mann als auch Frau ist, geht die Aufforderung also an ihn als eine Paar. Der Mensch wird nicht von ihm geschaffen (gemacht, wie es heißt), sondern er wird von ihm erzeugt. Offenbar werden der weibliche und der männliche Teil des Schöpfers aktiv. Sie disparieren sich, um dann in ihrer Vereinigung den Menschen zu erzeugen, ebenfalls nach dem göttlichen Vorbild als Mann und Frau.
In dieser Szene erfährt der Schöpfer also zum ersten Mal die in ihm ruhende Macht der Fruchtbarkeit, der Sexualität. Er nutzt diese Macht, um sich ein Gegenüber zu schaffen, das ihm ähnlich ist. Genau das aber findet jedes Mal statt, wenn Frauen und Männer Kinder zeugen. Diese Kinder werden zum Spiegel, zum Gegenüber für ihre Eltern. Was in der Person des Schöpfers anders ist als in den Personen von Frau und Mann, das ist die Fähigkeit, sich wieder mit sich selbst zu vereinigen und der EINE zu werden. In dem EINEN verschmelzen die weiblichen und männlichen Anteile wieder zu der göttlichen Entität. Vollkommen zu sein bedeutet für den Schöpfer also unzertrennlich weiblich und männlich zu sein. Dieser Vorgang, sich in seine sexuellen Potenzen von Frau und Mann zu zerlegen, um zeugend tätig zu werden, wird einmal bei der Zeugung der ersten Menschen sichtbar, dann erst wieder bei der Zeugung seines Sohnes. In der Zwischenzeit mutiert er aus der Sicht der Bibelschreiber zum männlichen Gott, der seinen zweiten personalen Teil verleugnet.
Der zweite Schöpfungsbericht lässt diese intellektuelle Einsicht in das Wesen des Schöpfers außer Acht. Hier ist alleine die Aktion des männlichen Teils dargestellt. Das Abbild dieses Mannes kann natürlich nur ein Mann sein, eben Adam. Der Schöpfer verleugnet seine weiblichen Anteile wird somit zum Töpfer, der einen Körper formt. Die Fähigkeit des Zeugens hat er verloren, weil ihm der weibliche Teil fehlt. Er geht den mühsamen Weg über das Körperformen, so wie Enkidu als Gegenpart des sagenumwobenen Königs Gilgamesch geformt und mit göttlichem Odem belebt wurde. (Bemerkung: In das Gilgamesch-Epos eingeflochten ist auch die Geschichte der Sintflut, die nur von Utnapaschtim und seinem Weib überlebt wird.) Diese aus dem babylonischen Mythenkreis übernommenen Vorstellungen sind leicht zu durchschauen. Adam wird genau scheitern wie Enkidu und letztlich Gilgamesch auch.
Die Person, die im Mittelpunkt des Dramas (Gen 2 ff.) steht, ist aber nicht Adam. Er ist passiv und langweilig. Ihm fehlt die Dynamik des Schöpfers. Er ist ein Zerrbild, wenn es darum geht, den Menschen als Ebenbild des Schöpfers zu sehen. In dieser einseitigen Handlungsweise unter Verzicht der weiblichen Anteile Gottes ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Er muss von Eva zu neuen Taten und neuen Ufern der Erkenntnis gedrängt werden. Erst Eva rettet die Schöpfungsdynamik und sprengt die Fesseln des Gartens.
Das ewig Weibliche und die (OHN)Macht des Mannes
Mit der Unterschiedlichkeit der beiden Schöpfungsberichte ist bereits der Boden für die kommende Saat der Auseinandersetzung zwischen Patriarchat und Matriarchat gelegt. In Gen 1 wird aufgezeigt, dass die wahre Ebenbildlichkeit des Menschen zum Schöpfer nur in der gleichberechtigten Form von Mann und Frau erreicht werden kann. Zugleich wird aber auch aufgezeigt, dass Fruchtbarkeit und Nachkommenschaft nur im Zusammenspiel Mann – Frau möglich sind. Die kurze Form dieser Darstellung und die isolierte Position dieses Textes, der zwar das Buch Genesis eröffnet, aber sich nicht fortsetzt, sondern ziemlich isoliert dastehend erscheint, machen klar, dass die Verfasser dieses Teils der Priesterschrift selbst nicht in der Lage waren, eine vernünftige Verflechtung mit Gen 2ff. zu erreichen. Sie fanden keinen Weg, den intellektuellen Standard aus Gen1 dem „naturgegebenen Durchschnittsverstand der gewöhnlichen Bevölkerung“ anzudienen und eine Synthese der beiden Berichte zu erstellen.
Der Grund ist offensichtlich.
Der weibliche Teil des Schöpfers war für den Menschen dieser Zeit nicht mehr denkbar. Aber er war in der Schöpfung selbst als Frau präsent. Die Fähigkeiten, die die Frau als Gebärerin besaß, waren für den Mann unerreichbar. Er mochte über Reichtum und Macht in dieser Welt verfügen, aber er würde nie in der Lage sein, ein Kind zu gebären. Ohne Kinder gab es aber keine Zukunft. Ohne Zukunft keine Erben für Reichtum und Macht. Das war für den Mann deprimierend. Er hatte einen Schöpfer kreiert, der Allmacht besaß, aber rein männlich gedacht war, was seine Göttlichkeit sofort einschränkte. Im Prinzip war er damit zeugungsfähig, aber nicht gebärfähig. Konsequent gedacht war er damit auch nicht zukunftsfähig. Was sollte man mit einem solchen „defekten“ Schöpfergott anfangen, zumal in allen Kulturen in der Nachbarschaft Fruchtbarkeitsgöttinnen verehrt wurden, die stolze Gefährten eines mächtigen Gottes waren?
Moses musste die Folgen am Berg der Gesetzgebung erfahren. Seine Abwesenheit genügte, um sofort ein goldenes Kalb zu schmieden, das Zeichen für den Gott Ba’al und mit ihm das Zeichen für Aschara, die Fruchtbarkeitsgöttin. Der Zorn des Moses als Verkünder des männlichen Alleingottes war so groß, dass er die Gesetzestafeln zerschlug. Doch für lange Zeit wurde die Mondgöttin von den Frauen verehrt, die ihr sogar Kuchen buken. Da half es auch nichts, sich für 40 Jahre in der Wüste aufzuhalten. Es fehlte einfach der eine Teil der Gottheit, in dem die Frauen sich hätten wiedererkennen können. So war es nötig, sie einem strengen Reglement zu unterwerfen, in der stillen Hoffnung, dass ihre Sehnsucht, sich in ihrem Gott wiederzufinden, eines Tages verschwinden würden.
Im Prinzip wurden die Frauen damit zu einer „gottfreien“ Gruppe gemacht. Sie brauchten ja keinen Gott, da der männliche Gott in den sie umgebenden und beherrschenden Männern ja ständig präsent war.
Für die Männer war das Geheimnis, das die Frauen als Gebärerinnen umgab, nicht lösbar. Sie verstanden den weiblichen Körper genau so wenig wie die Funktionen der Fortpflanzung. Die Frau wurde für sie das Gefäß, das sich ihnen nicht verweigern durfte, sobald der Heiratsvertrag geschlossen war. Sie sonderten sie ab und hüteten sie vor Kontakten mit anderen Männern. Dabei fühlten sie aber, wie sehr sei emotional von diesen Frauen abhängig waren. Das ging über das Bedürfnis, einen Erben zu zeugen, weit hinaus. Die Frauen gaben in den Familien weibliche Geborgenheit. Sie dachten und empfanden anders als die Männer. Auch die Versuche, ihnen das rationale Element abzusprechen, minderte die Anziehungskraft der Frauen in keiner Weise. Im Gegenteil, je mehr die Frauen zeigten, dass sie zu außergewöhnlichen Handlungen in der Lage waren, desto gefährlicher galten sie. So ist es eher eine wundersame Fügung, dass Frauen wie Esther, Judith oder Rut den Weg in die Schriften des AT fanden. Das Studium der Thora aber war den Frauen verboten. Sich mit Gott zu befassen und seine Geheimnisse zu ergründen, war Männersache.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Auf dem Weg zur Göttin : MARIA»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Auf dem Weg zur Göttin : MARIA» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Auf dem Weg zur Göttin : MARIA» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.