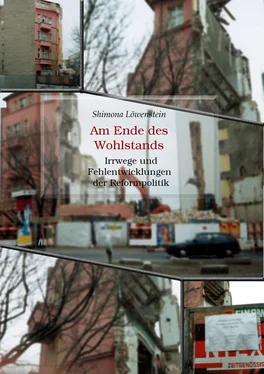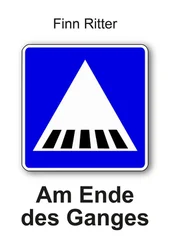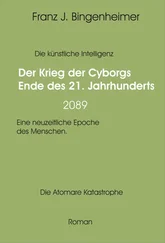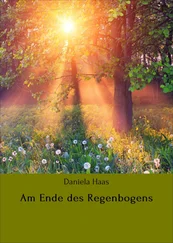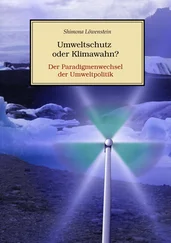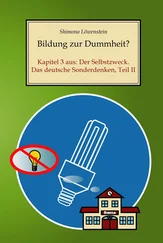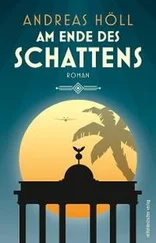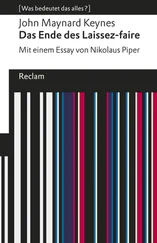Daß eine konsequente Steuerreform in der Union ebensowenig durchsetzbar ist wie in der SPD, wurde deutlich, als man merkte, wie schnell Vorschläge wie das Steuerkonzept von Friedrich Merz, mit dem man seine Steuererklärung „auf einem Bierdeckel“ berechnen könnte, oder auch die Reformvorstellungen von Paul Kirchhof, dem „Professor aus Heidelberg“ aufgeweicht, „weichgespült“ und zu einem halbherzigen Kompromiß verwandelt wurden. Dabei war Kirchhofs Argumentation nicht weltfremd, und auch nicht durch bloße Nützlichkeitserwägungen geprägt, sondern prinzipiell und (im Gegensatz zu den vielen Begründungen von Sonderrechten durch „soziale Gerechtigkeit“, „Gleichstellung“ usw.) gerade durch die Gerechtigkeitsvorstellung einer Rechtsordnung im Rechtsstaat (im Gegensatz zur Willkür) begründet: Diese beruht zugleich auf der Idee der Freiheit (der individuellen Selbstverantwortung, etwa für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg) und der Gleichheit, d.h. der rechtlichen Gleichbehandlung aller als eines elementaren Teils der Gerechtigkeit. Dem deutschen Steuerrecht ist aber nach seiner Meinung der Gerechtigkeitsgedanke weitgehend abhanden gekommen: das Steuerrecht verfehlt die gleichheitsgebotene Unausweichlichkeit, weil es durch die diversen Steuervergünstigungen und –anreize das Wirtschaften auf Nebenwege verleitet, in dem es nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit, sondern das steuertaktische Geschick begünstigt und zu unproduktiven Ausweichmanövern (Fehlleitung des Kapitals, Steuertricks) und Steuerhinterziehung einlädt. In dem von ihm vorgeschlagenen Modell sollte dagegen auf alle unnötigen Differenzierungen (etwa in bezug auf die Einkunftsart, Steuerklassen u.ä.) und Vergünstigungen (Ausnahmen, Lenkungs- und Privilegierungsbestände) verzichtet und die Einkommenssteuer vereinheitlicht werden. Das Steuerrecht soll für alle verständlich und als gerecht empfunden werden, die Steuererklärung so einfach sein, daß man darauf keine unnötige Zeit und Energie mehr verschwenden muß, und die Steuerlast wieder zu einer verläßlichen Planungsgrundlage werden. [46]
Der Wille zu einer Grundlagenreform des Sterrechts oder auch anderer Bestandteile der sozialstaatlichen Strukturen war aber auch bei den Christdemokraten nicht vorhanden. Ihre Politik besitzt ebenfalls keine tragbaren Konzepte. [47] An dieser Eigenbewegung in die Katastrophe konnte die Große Koalition und die Kanzlerschaft Angela Merkels, die weder ein sinnvolles Reformkonzept noch das Format einer Margret Thatcher besitzt, auch nicht viel ändern. Was seitdem an „Reformen“ angeboten wurde, brachte eher Spott oder Zorn der Öffentlichkeit als eine tragbare Lösung zutage. Dennoch werden diese „Mogelpakete“ als „notwendige tiefgreifende Reformen“ präsentiert, und zwar nicht nur von der politischen Prominenz selbst. Die an sich interessante Ausstellung über deutsche Sozialgeschichte In die Zukunft gedacht thematisierte zum Schluß auch die in den letzten Jahren vorgenommenen Änderungen in der Sozialpolitik: Gemäß Gerhard Schröders „Agenda 2010“ sollen eingeführte Arbeitsmarktreformen (Hartz-Gesetze), Gesundheits-, Pflege- und Rentenreform (z.B. Rente ab 67) sowie weitere sozialpolitische Maßnahmen (Förderung von Menschen mit Behinderungen und Familiengeld) die Wirtschaft und die Eigenverantwortung stärken und zugleich die Finanzierbarkeit der sozialen Systeme für die Zukunft sichern. Bei genauer Betrachtung handelt es sich jedoch bei den genannten Beispielen um bloße Einsparungen, Kürzungen, formale Umstrukturierungen, oft sinnlose oder verkehrte Maßnahmen, die die Situation der Menschen verschlechtern, ihren Zweck aber nicht erfüllen. [48] Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild, in dem illusorische Ziele mit realen Folgen verwechselt werden. [49]
Das ist nicht nur in den häufigen einander widersprechenden Erfolgs- oder Katastrophenmeldungen in den Medien, sondern auch in den verschiedenen quasiwissenschaftlichen Studien der Fall, die stets so angefertigt werden, um ein bestimmtes erwartetes oder verordnetes Ergebnis zu bestätigen. So verfaßte beispielsweise Ludwig Siegele 2005 in The Economist ein Loblied auf Deutschlands Reformfähigkeit und Gutergehen, das der Kanzler Schröder als Beweis für den Erfolg seiner Reformpolitik vervielfältigen ließ. Nur einige Monate später beschrieb derselbe Autor die Situation aus einer anderen Perspektive – mit einem anderen Ergebnis: Deutschland besitze zu verkrustete Strukturen, wenig Arbeitsplätze und schlechte Integration von Ausländern, es sei nicht attraktiv für Investoren und Hochqualifizierte, sein Bildungssystem begünstige soziale Ausgrenzung, und die große Koalition vermag mit ihren kleinen Schritten keine großen Reformen hervorzubringen. [50]
Das war natürlich nur ein weiteres Beispiel der allgemein bekannten pauschal oberflächlichen Kritik. Dennoch war der vorsichtige Optimismus, den der Herausgeber des Jahrbuchs 2006 des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands Jürgen Kocka in seiner Einleitung zum Ausdruck brachte, [51] durch eine Politik der kleinen Schritte, die die Große Koalition vermeintlich vollzieht, seien langsame Veränderungen möglich, ebensowenig angebracht wie sonstige phrasenhafte Bewertungen. Die genannten Beispiele aus den Bereichen Hochschul-, Familien-, Gesundheits-, Einwanderungspolitik usw. werden hier einzeln im Rahmen ihrer thematischen Zusammenhänge behandelt, im Unterschied zu dem Autor jedoch nicht nur als langsam und unzureichend, sondern oft als falsch oder verkehrt angesehen. Vom Politologen Wolfgang Merkel wurde die Situation auch anders beurteilt. Nach seiner Meinung könne bei der Großen Koalition weder von einem Pfadwechsel noch von konsequentem Handeln die Rede sein. „Durchwursteln“ statt Durchregieren kennzeichnet den bisherigen Regierungsstil, wodurch sich die Zukunftsfähigkeit Deutschlands wohl kaum sichern lasse. Seine Feststellung gilt sowohl der mißlungenen Gesundheitsreform als auch der halbherzigen Föderalismusreform sowie auch allen übrigen reformbedürftigen Bereichen des Sozialstaates, wie Deregulierung des Arbeitsmarktes oder Schuldenabbau. [52]
Diese letzte Option kommt inzwischen überhaupt nicht mehr in Frage; umstritten bleibt nur noch die jeweilige Höhe der Neuverschuldung – ein weiterer Grund für die eingeschränkte Handlungsfähigkeit des Staates. Diese wurde schließlich nicht nur durch die Krise der Parteien und deren Verflechtungen mit diversen Lobbys, sondern auch aufgrund wachsender Schulden diagnostiziert. Daß die Staatsverschuldung irgendwann an ihre Grenzen gelangen muß, spätestens dann, wenn die Zinszahlung das gesamte Steuervolumen auffrißt, bleibt dabei ebenso unberücksichtigt wie die negative Kopplung zwischen Steuererhöhung und Steuereinahmen. Die reale Bankrottsituation des Staates wird durch die Neuverschuldung nur hinausgezögert und durch das Dogma der fehlenden Insolvenzfähigkeit der öffentlichen Hand verdeckt. In den letzten Jahren sind zwar Ansichten aufgetreten, man sollte sich von diesem Dogma verabschieden, um die öffentlichen Systeme zu retten. Der Staatsforscher Gunnar Folke Schuppert schlug beispielsweise für die zahlungsunfähigen Bundesländer die Aufstellung eines Haushaltsnotlageregimes vor. [53] Die Empfehlungen von K.K. Konrad, man solle die Wettbewerbsfähigkeit des Bundes, der Ländern oder Kommunen steigern, indem sie diverse Tricks der Unternehmen nachahmen, wirken allerdings ziemlich lächerlich. [54] Nicht nur das: Ihre Verwirklichung könnte sich als selbstzerstörerisch erweisen.
Zu unerfreulichen Ergebnissen kamen auch weitere Autoren des erwähnten Bandes. Demnach können die bestehenden, auf individuelle Statussicherung statt Lebenschancengleichheit oder Armutsbekämpfung abzielenden Strukturen des deutschen Sozialstaates dessen zentrale Aufgaben (nach den Prinzipien Sicherheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit) nicht mehr gewährleisten. Statt dessen empfahlen sie verstärkte Investitionen in Bildung und Weiterbildung, soziale Dienstleistungen statt monetärer Transferleistungen und stärkere Steuerfinanzierung der Sozialsysteme. Inwiefern solche Investitionen oder Leistungen sinnvoll sind, wurde innerhalb ihrer Darstellung allerdings nicht untersucht. Die Durchsetzbarkeit solcher Reformoptionen in Deutschland wurde überdies von den Autoren sehr bezweifelt. [55] Es liegt nämlich in der Logik dieses „sozialpolitischen“ Denkens, daß das aus welchen Quellen auch immer eingenommene Geld nicht etwa gespart und sinnvoll investiert, sondern unproduktiv ausgegeben, verschenkt, ja verschwendet wird. Die Verschwendung ist sogar systembedingt, indem beispielsweise einzelne Behörden oder Institutionen gezwungen sind, das ihnen zugeteilte Geld innerhalb eines Zeitraums auszugeben, da ihnen ansonsten für die nächste Periode ihr Budget gekürzt wird.
Читать дальше