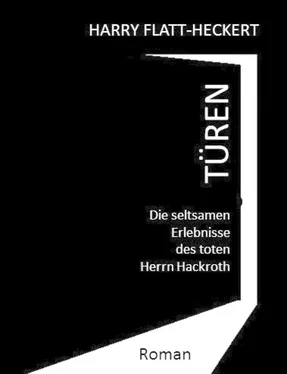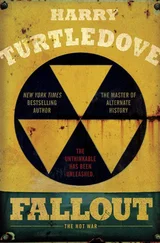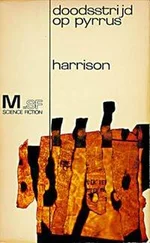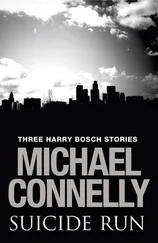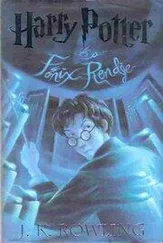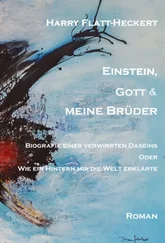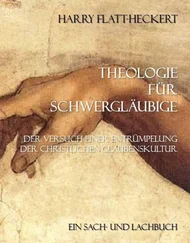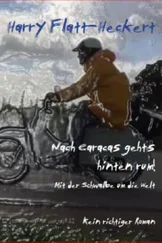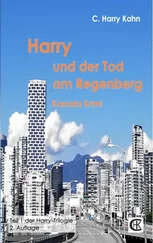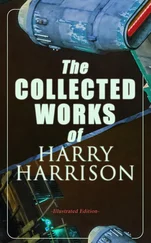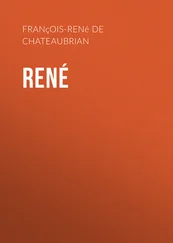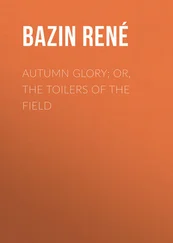Harry Flatt-Heckert - Türen
Здесь есть возможность читать онлайн «Harry Flatt-Heckert - Türen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Türen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Türen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Türen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Eine böse und eine schräge Geschichte.
Türen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Türen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zeit. Sie ordnete mein Leben, sie ordnete meinen Tag. Wenn ich wusste, dass es 20.05 Uhr ist, dann wusste ich eben auch, dass just in diesem Moment die Tagesschau im Ersten lief. Schon seit fünf Minuten lief und noch weitere zehn Minuten laufen würde. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. 20.05 Uhr gleich Tagesschau. Und wenn ich wollte, dann konnte ich mir die Tagesschau ansehen. Weil ich wusste, dass sie lief. Wenn ich nicht genau wusste, ob es vielleicht 19.48 Uhr oder 20.05 Uhr war, dann wusste ich auch nicht, was gerade im Fernseher lief. Tagesschau oder Küchenschlacht? Und mein Nichtwissen ließ mich Gefahr laufen, die Küchenschlacht einzuschalten. Und ich wollte die Küchenschlacht nicht sehen. Das Wissen um die Uhrzeit verlieh mir dagegen Macht über das Fernsehprogramm. Und über mein Leben. Wenn ich nicht wusste, wie spät es war – oder noch schlimmer - welches Datum wir hatten, geriet ich durcheinander. Vielleicht arbeitete ich deshalb auch beim Finanzamt. Wenn es der dreißigste eines Monats war, dann wusste ich, dass mein Gehalt auf meinem Konto war. Da konnte ich die Uhr danach stellen. Am dreißigsten war mein Gehalt da. Und zwar immer der exakt gleiche Betrag. Da gab es keine Prämien, Sonderzahlungen oder sonstige Abweichungen, die mich irritieren konnten. Nein, am dreißigsten war immer der exakt gleiche Betrag auf meinem Konto. Und sollte es einmal eine Veränderung geben, wegen einer Gehaltserhöhung etwa, dann wurde sie rechtzeitig angekündigt. Dann konnte ich mich darauf einstellen. Rechtzeitig.
Andererseits wusste ich auch, dass, wenn es der Zehnte eines Monats war, die steuerpflichtigen Betriebe, für die ich zuständig war, ihre Mehrwertsteuerschuld an die Kasse des Finanzamtes abgeführt haben mussten. Und wenn sie dieser Pflicht rechtzeitig nachkamen, dann war die Welt in Ordnung. Ihre und meine. Und wenn die Betriebe säumig wurden, dann waren sie nicht in Ordnung. Ich schon. Die Säumigkeit der anderen zeigte mir, dass ich in Ordnung war, denn ich war ja bereit, die Steuern zu vereinnahmen. Ich war vorbereitet. Zeit war also ein wesentliches Ordnungsprinzip und es verlieh mir Sicherheit. Und nun hatte ich so gar keine Ahnung, wie spät es wohl war.
So befremdlich mir das einerseits war, so seltsam wohlig war mir auch andererseits. Denn so viel Sicherheit mir die genaue Kenntnis von Datum und Uhrzeit zeitlebens gab, so sehr engte mich dieses Wissen oft auch ein. Oder es versetzte mich in Panik. Je nach dem. Da gab es durchaus eine gewisse Ambivalenz. In unserem jährlichen Urlaub in Bad Fallingbostel engte mich diese zeitliche Orientierungfähigkeit meistens sehr ein. Das genaue Wissen um Tag, Datum und Uhrzeit führte nämlich dazu, dass ich ganz unwillkürlich, beinahe stündlich, ausrechnete, wann wir die Heimreise anzutreten hatten. Noch sechs Tage, zwölf Stunden und dreiunddreißig Minuten. Noch vier Tage, fünf Stunden und zwanzig Minuten. Manchmal versuchte ich sogar den Abreisetermin so auszurechnen, dass die Zeit bis dahin nur aus Primzahlen bestand. Noch drei Tage, fünf Stunden und sieben Minuten. Das stand natürlich insofern einer wirklichen Erholung entgegen, als ich nie einen Blick für die Schönheit und Sehenswürdigkeiten von Bad Fallingbostel hatte, nie ein Essen wirklich genießen, nie unbeschwert die Dreisamkeit mit Gisela und ihrer Mutter würdigen konnte. Gisela meinte dann immer, ich würde mich hinter meinem Zahlenwerk verstecken, statt mit Leib und Seele am Hier und Jetzt teilzunehmen. Sie meinte das mit Nachdruck. Aber ich konnte diesem Zwang, den mein Wissen auf mich ausübte, nicht so ohne weiteres ausweichen. Er war einfach da. Ich musste rechnen. Und wenn ich versuchte – aus Rücksicht auf Gisela etwa – dieses Errechnen des Rückreisetermins zu vermeiden, diesen geradezu unwiderstehlichen Impuls zu unterdrücken, machte ich es für mich nur noch schlimmer. Dann versuchte ich nur, diesem Zwang noch heimlicher, noch beiläufiger, und möglichst von Gisela unbemerkt, nachzugehen.
Manchmal versetzte mich dieses Wissen aber eben auch in einen panikartigen Zustand. Wenn ich beispielsweise wusste, dass es 22.55 Uhr war und Gisela mir beim Fernsehen zuraunte, dass sie sich jetzt frisch machen ginge und mich nach den Tagesthemen im Schlafzimmer erwartete. Dann wusste ich, dass ich nur fünf Minuten hatte, um mich vorzubereiten. Mich auf eine Ausrede vorzubereiten, ein Ablenkungsmanöver einzuleiten oder einen Migräneanfall vorzutäuschen. Und in diesen fünf Minuten konnte ich den Tagesthemen nicht mehr richtig folgen. Das machte mich wahnsinnig. Wahnsinnig panisch.
Dass ich mich im Moment überhaupt nicht zeitlich orientieren konnte – ich wusste nur, dass heute Samstag war - war allerdings weder beengend noch löste es Panik in mir aus. Es sorgte aber auch nicht gerade dafür, dass ich mich nun ausgesprochen sicher fühlte. Es war mir merkwürdig gleichgültig. Allein der Gedanke, dass ich womöglich – nein, sicherlich - gestorben und nun mit hoher Wahrscheinlichkeit für längere Zeit, wenn nicht sogar für immer, tot sein würde, beruhigte mich indes doch ein wenig. Aber ein wenig beunruhigte mich der Gedanke auch. Aber nicht so sehr, weil es so war, nicht, weil ich tot war, sondern weil ich nicht wusste, was nun auf mich zukommen würde. Das konnte ich nie gut haben. Nicht zu wissen, was kommen würde. Mich überraschen lassen zu müssen. Für vielleicht immer keine Sicherheit mehr zu haben. Außer der, tot zu sein.
*
Für immer. Das war schon sehr früh ein Gedanke, der mir auf eigenartige Weise ambivalent war. Dass meine Mutter für immer tot sein würde und ich sie für immer vermissen werden müsste, erschreckte mich zwar als Kind, die Hoffnung, dass mein Vater ebenfalls für immer von mir gegangen war, erfüllte mich später dagegen mit tiefer Ruhe und Entspannung. Ich vermisste ihn nicht. Überhaupt nicht. Es war für mich eine regelrechte Befreiung. Denn nun würde ich für immer Ruhe haben. Das durfte ich natürlich niemandem sagen. Dafür hätte niemand Verständnis gehabt. Wie auch? Aber das erwartete ich auch nicht. Ich musste auch gar nicht darüber reden, ich redete ja ohnehin nicht viel. Ich redete nicht, und mit mir wollte eigentlich auch nie wirklich jemand reden. Allerdings war auch zu befürchten, dass ich dafür dieses diffuse Schuldgefühl, das mich seit dem Tod meiner Eltern beschlichen hatte, ebenfalls für immer behalten würde. Es gab mir natürlich niemand offen die Schuld daran. Aber sie ließen mich spüren, dass ich es war. Sie ließen es mich spüren und hofften gleichzeitig, dass ich es nicht merken würde. So, wie ich nie etwas merkte. Meinten sie.
Dass ich aller Voraussicht nach und hoffentlich nicht für immer bei Tante Hedwig, Onkel Franz und meinen nervenden Cousinen würde leben müssen, weil ich ja ganz sicher und ganz bestimmt irgendwann auf eigenen Beinen stehen würde, war eine durchaus anzustrebende Aussicht. Auch die Gewissheit, dass meine Zeit auf dem blöden Gymnasium in Schillig, das ich so sehr hasste, auch nicht mehr für immer dauern würde, erfüllte mich mit unbändiger Vorfreude auf das Ende von „für immer“. Dafür würde ich wohl sicher auch für immer als Loser in die Annalen der Schule eingehen. Für immer würde ich die Flasche, der Hansel, das Synonym für Versagertum sein. Aber was scherte mich das? „Für immer“ war also für mich ein durchaus zweischneidiges Schwert. Einerseits beruhigte mich der Gedanke an Konstanz, an Stetigkeit und Verlässlichkeit, weil ich mich so nicht ständig auf etwas Neues einstellen musste. Ich hasste Veränderung. Andererseits ängstigte mich dieser Gedanke auch, weil er mir so wenige Ausstiegchancen ließ. Das war diese unheimliche Ambivalenz, die mich so verwirrte. Dieses Einerseits und das Andererseits. Ich musste das wohl aushalten, wie es schien. Für immer.
*
Und nun sollte ich für immer tot sein. (Ich weiß gar nicht, ob ich hinter diesen Satz ein Ausrufe- oder Fragezeichen machen soll. Darum habe ich sicherheitshalber nur einen Punkt gesetzt.) Sei es drum. Nun also tot. Gut. Ich war einverstanden. Wenn auch nur schweren Herzens. Was blieb mir in diesem Moment auch anderes übrig? Ich wusste ja auch nicht, ob mir das Totsein gefallen würde. Für immer. Ich wusste nur, dass ich nicht für immer hierbleiben konnte. In diesem erstarrten und allmählich kälter und kälter werdenden Äußeren, in dem mein Inneres keine Heimstatt mehr haben konnte. Es wurde Zeit für mich. Zeit, die Sicherheit meines Äußeren aufzugeben und mich mit meinem Inneren auf Neues einzulassen. Nun denn, also. Ich zog die Hände vorsichtig, ganz vorsichtig aus beiden Armen, umschlang mich im Innersten selbst, um mir etwas Wärme zu bewahren. Aber je länger es dauerte, desto klarer wurde mir, dass mein Äußeres und mein Inneres sich nun bald voneinander verabschieden mussten. Mir wurde schlagartig klar, dass das nicht nur eine Frage der Temperatur war, nein, es war die Frage danach, wie lange mein Äußeres und mein Inneres überhaupt noch so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl hatten. Aber hatten wir das jemals? Waren wir jemals eine Einheit? Ich hatte Angst, mir diese Frage zu beantworten. Wahnsinnige Angst. Sicher, ab und zu gelang mir diese Einheit. Wenn ich es schaffte, das Glück einfach so in den Abfluss zu schleudern und mein Unglück tatenlos danebenstand. Mein Unglück, meine Schuld und mein Ich, das mir in solchen Momenten oft so fremd war.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Türen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Türen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Türen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.