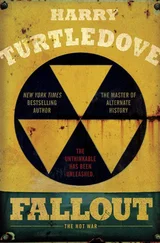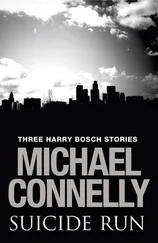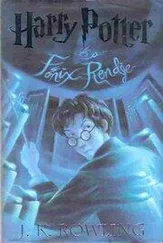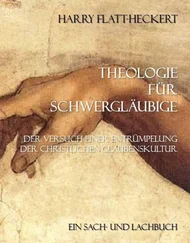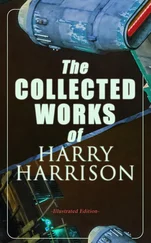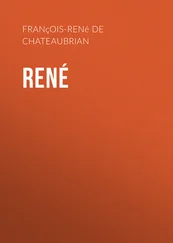So richtig glücklich war ich, soweit ich mich erinnerte, nur einmal. Als ich meinen ersten Orgasmus hatte. Da war ich ungefähr vierzehn. Ich lag in der Badewanne im Haus meiner Tante – ich badete für mein Leben gern – und fing irgendwann einfach an, an mir herumzuspielen. Zunächst etwas unmotiviert und orientierungslos. Als ich aber merkte, welch angenehmes Gefühl ich dabei hatte, mit zunehmender Vehemenz. Diese Vehemenz, dieser Lustgewinn steigerte sich selbst noch, als sich in dieses äußerst angenehme, mir so fremde Kribbeln in meiner Leistengegend so etwas wie Schuld mischte. Schuld kannte ich ja. Und etwas Schönes als absolute Größe gestand ich mir damals nicht zu. Ich ging plötzlich mit einer Zielorientiertheit zu Werke, die ich gar nicht kannte. Ich wollte dieses Ziel, von dem ich keine Vorstellung hatte, wie, wo und was dieses Ziel sein konnte, erreichen. Um jeden Preis. Und dann war es da. Das Ziel. Und es zerriss mich schier. Es war ein so unglaubliches Gefühl, weil es einfach aus mir selbst heraus erstand, aus dem Unerwarteten, aus dem Nicht-Gekannten. Und das Unglück stand dabei wie selbstverständlich Pate. Es stand einfach dabei und ließ dem Glück neben sich einfach großzügig Platz. Und der Schuld. Sie konnten einfach gleichzeitig da sein. Das Unglück, das Glück und die Schuld. Ich konnte mitten im Unglück glücklich sein. Damals gab es keine Abwesenheit von Unglück. Es war nur Glück dazugekommen, ein Glück, das ich völlig sinnlos – oder besser sinnfrei – in den Abfluss unserer Badewanne schleudern konnte. Glück konnte ich schleudern. Was für ein Gefühl. Das einzige Gefühl, das ich nur für mich hatte und zu nichts in Beziehung stand, außer zu mir selbst. Mein Gefühl. Ein Gefühl, das ich mit niemandem teilen musste. Das ich für mich haben durfte. Nur für mich. Mehr hatte ich nicht. Und meistens schämte ich mich für dieses Gefühl. Verbot es mir. Das Glück. Meistens. Wegen der Schuld.
Und nun lag ich da. Tot, aber dennoch merkwürdig in Ordnung. Oder gerade deswegen. Wie gesagt, der Tod machte mich nicht gerade glücklich. Wie auch? Aber er machte mich auch nicht unglücklich. Überhaupt nicht. Und seltsamerweise fühlte ich mich auch überhaupt nicht schuldig. Kein Stück. Schuld war in diesem Zustand offensichtlich keine relevante Größe mehr. Weder Glück, Unglück noch Schuld schien es noch für mich zu geben. Nichts mehr davon. Die schienen sich, als sich der Tod in mir ausbreitete, einfach aus dem Staub gemacht zu haben. Dafür machte sich jetzt in mir so eine merkwürdige Ruhe breit. Ja, irgendwie beruhigte mich der Gedanke, dass ich tot war. Statt Unglück, Glück und Schuld herrschten nun Ruhe und Ordnung. So, wie ich es am liebsten hatte. Vor allem Ordnung. Und wenn dieses Gefühl von Dauer sein sollte, dann war ich gern bereit, dafür mein Leben zu lassen. Das war es wert. Mein Inneres streckte sich entspannt in meinem Äußeren aus. Aber ich merkte auch, dass ich hier nicht länger bleiben konnte. Ich fror nun doch ganz fürchterlich.
Ich muss gerade siebzehn gewesen sein, als mein Vater starb. Eigentlich starb er gar nicht, sondern er nahm sich das Leben. Länger hielt er es ohne meine Mutter nicht aus. Machte sich mit seiner alten Dienstpistole in seinem Lesezimmer ein Loch ins Herz. Darin war etwas, das raus musste. Es brauchte dieses Loch, weil es so eng darin geworden war. Der Schmerz musste über die Jahre in seinem Herzen so angeschwollen sein, dass kein Platz mehr für etwas Anderes darin war. Auch nicht für mich. Auch mich vertrieb der Schmerz endgültig aus seinem Herzen. Die letzten zwei Jahre vor seinem Tod hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Wir hatten zwar immer mal wieder miteinander telefoniert, aber uns nichts zu sagen. Und nicht gesehen. Nicht mal an Weihnachten oder zu den Geburtstagen. Er hatte immer irgendwelche Entschuldigungen und Ausreden, warum er mich nicht sehen konnte. Oder wollte. Mal schob er eine Krankheit vor, mal irgendwelche Termine. Wahrscheinlich konnte er meine Gegenwart einfach nicht ertragen, weil ich ihn vielleicht zu sehr an meine Mutter erinnerte oder der Gedanke, dass ich schuld an ihrem Tod war, sich in ihm festsetzte. Nicht, dass ich ihn vermisst hätte. Nein, ich habe ihn nicht vermisst. Aber ich war es seit dem Tod meiner Mutter gewöhnt, ihn alle zwei Monate und auch in den Ferien zu besuchen. Regelmäßig. Ich freute mich nie sonderlich auf diese Treffen. Sie waren für mich wie Zahnarztbesuche. Nicht schön, aber notwendig. Ich hatte auch Angst vor dem Zusammensein mit meinem Vater. Er machte mir diese Angst, weil er durch sein still vor sich hin leidendes Auftreten dieses Schuldgefühl in mir nur noch verstärkte. Er sprach einfach nicht mit mir. Zumindest über nichts, was über meine Essenswünsche oder die Abfahrtzeit des Zuges, der mich wieder zurück zu meiner Tante bringen sollte, hinausging. Die Wochenenden, an denen ich ihn besuchte, zogen sich endlos wie Kaugummi. Er schwieg vor sich hin, er seufzte vor sich hin und wartete darauf, dass er wieder in seinem Lesezimmer verschwinden konnte, weil ich fernsah oder ins Bett ging. Und wenn ich den Zug bestiegen hatte, drehte er sich gruß- und wortlos um und verließ den Bahnsteig. Ich war schuld. Und nun war ich auch noch an seinem Tod schuld. Schuldig des Doppelmordes an meinen Eltern.
Die Beerdigung war entsprechend traurig. Oder armselig. Oder armselig traurig. Die Kapelle war dunkel, muffig und außer einem langweiligen Blumengebinde, auf dessen Schleife „In ewige Liebe. Dein Sohn“ stand, gab es keinerlei Schmuck. Dass das Wort „ewiger“ in „ewige“ verkürzt worden war, war das einzig Erheiternde an dieser Veranstaltung. Manchmal ist die Ewigkeit eben doch kürzer als man denkt. Ich hatte das Gebinde telefonisch direkt bei der Friedhofsgärtnerei bestellt und es vorher also nicht in Augenschein genommen. Sonst wäre mir dieser Fehler sicher aufgefallen. Der Pfaffe faselte was von Schicksal und von der Sünde, die im Suizid stecke, und dass wir, respektive mein Vater, ja dennoch auf die Vergebung Gottes, wenn auch nicht vertrauen, so doch wenigstens hoffen dürften. Die Hoffnung stürbe schließlich zuletzt. Immer. Aber am Ende eben doch. Dachte ich. Die Musik war noch erschütternder als das, was der Pfaffe von sich gab. Ein etwas morbide anmutender Mittsiebziger quälte das völlig verstimmte und überforderte Harmonium in die musikalischen Niederungen eines „So nimm denn meine Hände“ und eines „Befiehl du deine Wege“, dass es den Komponisten ohne Zweifel nur hätte recht sein können, wenn es sich um ihre eigene Beerdigung gehandelt hätte. Als die quälend lange Trauerfeier endlich zu Ende war und wir den Sarg zum Grab meiner Mutter geleiteten, fing es auch noch an, wie aus Eimern zu regnen. Ich fand das nur konsequent. Der Sarg wurde in die Gruft hinabgelassen und als ich etwas Erde auf die Kiste warf, in der die sterblichen Überreste meines Vaters lagen, erinnerte mich das Geräusch an das Peitschen, das der Teppichklopfer auf meinem Arsch hinterließ. Die Blume, die ich in der Hand hielt, legte ich zum Abschied auf das Grab meiner Mutter.
Außer mir war noch Tante Hedwig da, weil sie mich nicht allein lassen wollte. Und Onkel Franz, weil er Tante Hedwig nicht allein mit seinem neuen Auto fahren lassen wollte. Meine Cousinen kamen nicht mit. Sie kannten meinen Vater gar nicht.
Wie spät war es wohl jetzt? Fünf, sechs Uhr? Vielleicht sieben Uhr? Ich hatte gar kein Zeitgefühl mehr. Vor neun würde Gisela mich jedenfalls nicht vermissen. Neun Uhr wäre zwar spät, aber es war Wochenende. Samstag. Da konnte es schon mal sein, dass es neun Uhr wurde, bevor ich aufstand. Normalerweise würde es ihr erst auffallen, wenn ich nicht, wie sonst immer, mit einem Tee vor ihrem Bett stehen würde. Das machte ich immer so. Ich brachte ihr Tee. Jasmintee. Jeden Morgen. Heute würde ich das nicht hinbekommen. Befürchtete ich. Ich bekam Schuldgefühle bei diesem Gedanken. Gab es Schuld also doch noch für mich. Auch, wenn ich tot war. Nicht, dass sie nicht in der Lage gewesen wäre, sich selbst einen Tee zu kochen. Das konnte sie schon. Das wusste ich. Natürlich konnte sie das. Aber sie war es eben nicht gewohnt. Und nichts regte sie mehr auf, als dass irgendetwas ihre Gewohnheit störte. Das brachte sie immer so durcheinander. Nichts hasste sie mehr als Durcheinander. Dafür liebte ich sie. Dass sie das Durcheinander hasste. Wie ich. Ich fand es auch überhaupt nicht komisch, dass ich nicht wusste, wie spät es war. Zeit war ein hervorragendes Ordnungsprinzip.
Читать дальше