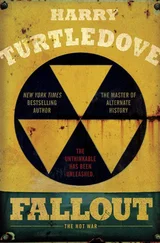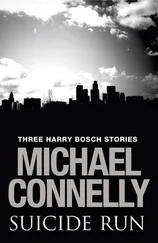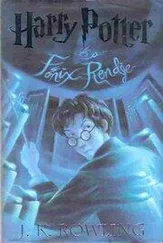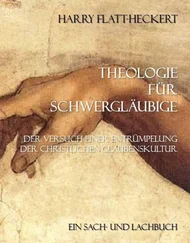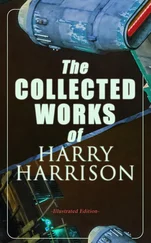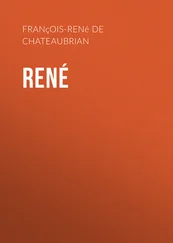Ich trennte angewidert und auch etwas gekränkt meinen Blick von meinem Gehirn und ließ ihn langsam durch den vorderen Bereich meines Kopfes hinunter durch die Nebenhöhlen in den Mund, den Hals und diesmal auch bewusst durch den Kehlkopf die Speiseröhre hinab gleiten. Ich wollte mir das von innen anschauen. Aber auch das war kein besonders erhebender Anblick, dachte ich angeekelt. Überall waren da so kleine. lappige Aussackungen, in denen sich noch irgendwelche Essensreste befanden. Hier und da ein paar warzenartige, blutgefüllte Verknorpelungen, die auch keinen sonderlich appetitlichen oder wenigstens gesunden Eindruck auf meinen Blick machten. Insgesamt war ich schon ziemlich erschüttert über den Anblick, den mein Innerstes mir bot. Endlich erreichte mein Blick die Stelle, an der meine Speiseröhre meinen Magen erreichte. Mein Blick sah sich um. Es war auf die Schnelle nichts zu sehen, was jetzt besonders auffällig gewesen wäre. Die Narbe sah auf den ersten, zugegebenermaßen eher laienhaften Blick gut aus, es war alles gut verwachsen. Zumindest schien es so. Wahrscheinlich war da auch gar nichts und ich bildete mir die Schmerzen über all die Jahre nur ein. Ich bildete mir ja immer viel ein. Und hielt es dann für wahr. War mir jetzt auch egal. War mir in diesem Moment auch zu kompliziert. Ich hatte jetzt andere Probleme.
Während meine Hand jetzt meinen Magen von außen abtastete, machte sich mein Blick auf den Rückweg. Er hatte genug gesehen. Er wollte zurück. Dieser Ausflug war nicht sonderlich erquicklich für mich. Im Gegenteil. Mein Blick hatte die Nase voll. Gestrichen voll. Ich fragte mich kurz, ob ein Blick überhaupt eine Nase hatte? Ich wusste es nicht und darum verwarf ich diesen blöden Gedanken auch schnell wieder. Weil er blöd war. Ein wirklich blöder Gedanke. Auch meine Hand hatte jetzt genug. Meine, hilflos in meinem Inneren herumtastende Hand hatte diagnostisch nichts zur Klärung meiner derzeitigen Situation beitragen können. Gar nichts. Handarbeit hatte ich nie einen besonderen Wert beigemessen. Ich war immer mehr ein Kopfmensch. Und mein Kopf sagte mir jetzt, dass es Zeit wurde. Es wurde Zeit, dass dieser Spuk ein Ende hatte. Ich versuchte, mich innerlich allmählich wieder zu sortieren, schob meine Hand zurück in meinen Arm, bettete meinen Blick wieder in meine Augen, versuchte mich innerlich wieder in meine äußere Hülle hineinzufinden und wartete ungeduldig darauf, nun endlich richtig wach zu werden. Oder einzuschlafen. Ich glaubte allerdings nicht, dass ich nach diesem absurden Trip in mein Inneres noch einmal würde einschlafen können. Der Kopf war viel zu wach und viel zu aufgeregt, um jetzt die nötige Ruhe zu finden. Dann jetzt bitte wenigstens richtig wach werden. Ich hatte genug. Und ich war verängstigt. Verängstigt, verwirrt, verzweifelt und irgendwie fühlte ich mich völlig hilflos. Das musste jetzt enden. Am liebsten sofort. Aber jeder Versuch, nach dieser verstörenden Reise in mein Inneres auch wieder die Kontrolle über mein Äußeres zu erlangen, scheiterte kläglich. Ich wusste nicht weiter.
Ich wusste oft nicht weiter. Vielleicht lag das daran, dass ich oft einfach nicht weiterwusste. Vor allem, wenn mir niemand sagte, wie es weitergehen würde. Oder sollte. Oder müsste. Seit dem Tod meiner Mutter wusste ich nicht wirklich weiter. Ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass es ein „weiter“ geben könnte. Wo sollte das auch sein? Oder wie? Seit damals hatte ich auch keine eigenen Entscheidungen mehr getroffen. Ich hatte mich einfach gefügt. In den Tod meiner Mutter, in die Härte meines Vaters und in die Barmherzigkeit meiner Tante Hedwig. Auch in die Zickigkeit meiner Cousinen fügte ich mich letztlich. Nicht, dass sie nicht freundlich zu mir gewesen wären. Mir gegenüber waren sie freundlich. Meistens. Vielleicht war es auch nur Mitleid, das sie mir gegenüber freundlich sein ließ. Kann sein. Aber sie waren eben auch Mädchen. Und da die beiden ein wenig älter als ich waren, nahmen sie mich nicht sonderlich ernst. Sie gaben mir mit ihrem Mädchensein immer irgendwie das Gefühl, dass ich nicht richtig war, dass mit mir etwas nicht stimmte. Dass ich nicht in Ordnung war. Nicht wie sie. Sie wussten, was sie wollten, wussten mindestens genauso gut, was sie nicht wollten und vor allem wussten sie, wie sie beides durchsetzen konnten. Ständig lachten oder tuschelten sie über irgendetwas, das ich nicht verstand, andauernd begeisterten oder ereiferten sie sich für oder über etwas, das ich nicht nachvollziehen konnte. Ich fand einfach keinen Zugang zu ihrer Welt und meine blieb ihnen auch verschlossen. Aber wahrscheinlich hatte ich im Gegensatz zu ihnen auch gar keine Welt. Vielleicht war ich weltenlos. Ich wusste auch nicht, was ich wollte. Weder hatte ich eine konkrete Vorstellung davon, was ich später einmal beruflich machen würde, noch gab es etwas, wofür ich mich begeistern konnte. Sie wussten, was sie wollten. Christa wollte Kosmetikerin werden und Ute wollte heiraten. Irgendwie. Oder geheiratet werden. Das war ihr Plan. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte nichts. Keine besonderen Hobbys, keine tiefergehenden Interessen, die mich umtrieben. Ich machte einfach, was man von mir erwartete, was man mir vorschlug oder für mich entschied. Ich ging zur Schule, weil ich zur Schule gehen musste, ich ließ mir die Haare schneiden, wenn meine Tante meinte, es sei Zeit dafür, ich mähte den Rasen oder ging Fußball spielen, wenn Onkel Franz mich dazu aufforderte und ich hielt die Klappe, wenn meine Cousinen über irgendwelche Mädchengeschichten tratschten.
Freunde hatte ich damals eigentlich auch nicht. Ich hatte Klassenkameraden, mit denen ich die Schulbank drückte. Ich hatte andere Kinder, die mit mir gemeinsam hinter dem Ball herrannten, sich aber vor allem über mich lustig machten, weil ich nicht so der allertollste Spieler war. Ich war einfach zu schmächtig, zu zurückhaltend, um mich gegen andere Mitspieler durchzusetzen. Ich hatte Mitkonfirmanden, die mit mir die Gebote und die Gebräuche der Kirche lernten. All das hatte ich. Wie jeder andere auch. Aber ich hatte keine Freunde. Ich wollte auch keine Freunde. Nicht solche. Ich konnte mit dem, womit sich andere Jungen in meinem Alter befassten, einfach nichts anfangen. Es war mir zu roh, zu laut, zu gewaltsam. Wie mein Vater. Der war auch roh, auch wenn er seine Rohheit unter dem Gewand einer strengen, protestantisch-preußischen Rechtschaffenheit und Disziplin zu verbergen versuchte. Ich vermisste meine Mutter. Ich vermisste ihre Zartheit, ihre Liebe, ihre unbedingte Liebe. Tante Hedwig bemühte sich. Sie bemühte sich wirklich. Sie war auch lieb. Vielleicht hatte sie mich sogar lieb. Irgendwie. Aber sie war anders. Sie war eben nicht meine Mutter.
Ich hatte mich irgendwann dazu entschlossen, die Zeit bis zu meinem Erwachsensein einfach zu ertragen. Sie einfach auszuhalten. Ich hatte auch gar nicht vor, sie irgendwie zu gestalten. Ich wollte sie nur ertragen. Sie hinter mich bringen. Wie eine Grippe. Meine späte Kindheit und frühe Jugend wurde mir zu einer Tunnelzeit. Zu einer Zeit, durch die ich einfach hindurchmusste, wenn ich von einer hellen Zeit, die irgendwo, lang vergessen, hinter mir lag, zu einer anderen hellen Zeit, die irgendwo, noch nicht zu erahnen, vor mir liegen sollte, zu gelangen. Ich durchschritt diesen Tunnel, ohne den Tunnel selbst als etwas Wichtiges wahrzunehmen. Er war nur da. Wie die Zeit. Einfach da. Ich musste da hindurch. Ich hatte auch keine Vorstellung davon, was mich am Ende dieses Tunnels erwarten würde. Ich hatte kein Bild von dem Licht, das da vielleicht auf mich warten würde. Wenn es denn überhaupt auf mich warten würde. Dennoch musste ich durch dieses Dunkel hindurch, auch wenn es kein Weiter gab, das mich antrieb. Es zog mich auch nichts. Nein, das vor mir liegende Licht zog mich nicht. Ich konnte es ja nicht einmal sehen. Nein, ich ging, weil ich gehen musste. Weil man mir sagte, ich müsste da hindurch. Also ging ich einfach. Durch die Zeit, durch meine Kindheit, durch meine Jugend, ohne wirklich weiter zu wissen. Ich ging nur. Das einzig Gute war, dass ich von ganz allein groß wurde. Ich brauchte dafür nicht viel zu tun. Es geschah einfach. Ich ließ es einfach geschehen. Ich ging durch eine Tür hindurch, nur um bald durch eine andere hindurch schlüpfen zu können.
Читать дальше