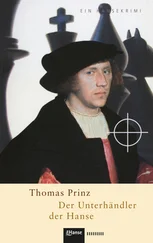Das Erlebnis im weichen Stroh der Scheune hat sich, in ähnlicher Form, noch einige Male wiederholt. Erst ganz allmählich geriet auch diese Beziehung unter das Mühlrad der Zeit. Aber noch heute trage ich die Gewissheit im Herzen, dass es uns gelungen ist, den Moment der ersten Verliebtheit zur reifen Liebe zu entfalten, einer Liebe, die nie stärker war als an jenem Tag, da unsere Tochter zur Welt kam. Diese Liebe war wie ein seltenes Juwel, das wir im Herzen trugen, als wir eine Familie waren.
Doch nun, wo Carolina fehlte, war alles anders. Der Tod unserer Tochter trieb einen Keil zwischen uns. Das Gift der Entfremdung wirkte langsam, sodass wir nach Natalies Rückkehr und einer ernst gemeinten Versöhnung zunächst noch fest an die Heilsamkeit geteilten Leides glaubten.
Natalie bemühte sich jedenfalls um Verständigung, und ich bilde mir ein, dass ich es auch tat, doch in Wahrheit saßen wir schon längst nicht mehr im selben Boot. Wir waren Schiffbrüchige, die beide der Rettung bedurften. In unserer Hilflosigkeit schlugen wir Wege ein, die wie zwei Parallelen nicht mehr zueinander fanden.
Natalie begann, aus Carolinas Kinderzimmer eine Art Tempel zu machen. Fotos lagen auf dem Schreibtisch, die dort nicht hingehörten. Auf dem Stuhl thronte Carolinas Lieblingspuppe mit der Bürste in der einen und dem Spiegel in der anderen Hand. Der Einkaufsladen, den Carolina bereits ein Jahr zuvor eigenhändig in den Keller verfrachtet hatte, fand sich plötzlich vor dem Bücherregal wieder. Die Märchenbücher der Gebrüder Grimm und von Hans Christian Andersen verschwanden aus der Wohnzimmerbibliothek. Jetzt lagen sie in Carolinas Nachtkästchen.
Das alles war sehr sonderbar. Ich sprach Natalie darauf an, aber sie ertrug es nicht. Da riet ich ihr, professionelle Hilfe aufzusuchen, worauf sie lapidar entgegnete, dass wir das beide nötig hätten. Während ich mir immer sicherer war, dass es niemanden gab, der mich auf meinem Weg begleiten könnte, ging Natalie tatsächlich zum Psychologen. Einmal verbrachte sie im Anschluss an eine Sitzung den ganzen Nachmittag damit, mir Satz für Satz auseinanderzusetzen, was der Therapeut gesagt hatte. Hatte ich anfangs noch verständnisvoll auf ihre zunächst vernünftig klingenden, dann aber zunehmend mythologisch verbrämten und pathetisch vorgetragenen Äußerungen reagiert, wich die ursprüngliche Zugewandtheit bald einem dumpfen Ärger, den ich im Zuge der gebotenen Höflichkeit nur mit viel Mühe zu beherrschen wusste.
Bald darauf wurde ich all dessen überdrüssig. Ich machte mich gewissermaßen aus dem Staub. In dem Maße, in dem Natalie meine Nähe suchte, verweigerte ich sie ihr, denn der Gedanke, dass sie nicht meine Nähe suchte, und es nicht mein Mitleid war, das sie zu erregen hoffte, ich also lediglich als Projektionsfigur für ihren grenzenlosen Schmerz herhalten sollte, war mir unerträglich. Überwältigt von der Wucht meiner eigenen Bitterkeit gab es in mir keinen Platz für den Schmerz eines anderen. Natalie erkannte schnell, was dies zu bedeuten hatte. Ich hatte das Band unserer Liebe durchschnitten und einer verhängnisvollen Kraft, die sich in meinem Herzen zu entfalten begann, die Erlaubnis erteilt, in unsere Geschicke einzugreifen.
Der Mörder wurde in Untersuchungshaft genommen. Zum ersten Tag der Gerichtsverhandlung waren zahlreiche Vertreter der Presse erschienen. Der Fall hatte viel Aufsehen erregt, sodass man unter Berücksichtigung von Einschaltquoten, Auflagenhöhen und Karriereperspektiven der Berichterstatter auf eine intensive Dokumentation nicht verzichten konnte. Zu Wort meldeten sich viele, doch kaum einer wusste etwas Substanzielles zu sagen. Der Gehalt der Stellungnahmen entsprach dem Niveau der sinnlosen Fragen. Sie hätten besser den Mund gehalten, wenn schon nicht aus Respekt vor der Toten, dann doch wenigstens aus Achtung vor sich selbst. Es waren Szenen wie aus Tierdokumentationen, sie blieben mir gut in Erinnerung. Die Aasgeier fallen über den Kadaver her und schlagen sich um die besten Brocken. Blitzlichtgewitter wie auf dem roten Teppich. Der Höhepunkt einer durch und durch voyeuristischen Verbrecherjagd: Dem Monster wird der Prozess gemacht. Und so nahm es nicht wunder, dass ganz Deutschland im Bilde zu sein glaubte – aber niemand außer mir wusste um die Lebensfreude und das wunderbare Lachen des Mädchens, das er aus dem Leben gerissen hatte. Niemand außer mir wusste, was dieses Monster wirklich getan hatte. Und da spürte ich sie wieder, diese mächtige Kraft, die mich würgte und knebelte und endlich in einen Abgrund voll brennenden Hasses entließ.
In der Nacht nach der Prozesseröffnung erwachte ich aus einem schweren, traumlosen Schlaf, der weder Erfrischung noch die Hoffnung auf einen besseren Tag gebracht hatte. Kaum aus dem Bett, begann ich einen Artikel über die Persönlichkeitszüge von Menschen, die Tötungsdelikte begangen haben, zu lesen, schob den Text aber sogleich wieder beiseite. Ich ging in den Garten, sah in den sternklaren Himmel hinauf und spürte die Leere in mir. Ich setzte mich auf die Bank und verfiel in einen Zustand, der mich weder Kälte noch Feuchtigkeit spüren ließ. Und dennoch: Diesem schweren Dämmerschlaf entwuchs die Imagination, dass kein Richter, kein Psychiater und kein Volk das Recht habe, den Mörder zu richten. Ich gelangte zu der Überzeugung, dass dieses Recht mir allein zustünde, und dass ich einen naturgegebenen Anspruch darauf hätte. Ich war der Überlebende des Verbrechens, das an meiner Tochter begangen wurde. Nur mir allein konnte das Recht der Vergeltung zufallen, ich allein würde die Strafe bemessen.
Hatte man dies nicht über Jahrhunderte hinweg so gehalten? Ich konnte nicht erkennen, warum sich jemals etwas daran hatte ändern können, und beschloss, Beweise für die neu gefasste Überzeugung zu sammeln. Ich würde den Richter von den Vorzügen des natürlichen Rechtsempfindens gegenüber allen modernen Strafrechtsideen, so geistreich und exquisit diese auch begründet sein mochten, überzeugen. Ich hatte eine Wahrheit gefunden, und sie leuchtete ohne Fehl und Tadel, sie war frei von Falschheit und Arglist. Mit dieser Wahrheit als Unterpfand würde ich in den Verlauf des Verfahrens eingreifen: Ich würde dem wahren Recht meiner Tochter und meinem natürlichen Recht als Vater Genüge tun.
Als ich erwachte, waren meine Beine steif vor Kälte, aber ich machte mir nichts daraus. Beseelt von der Perspektive, die sich mir eröffnet hatte, ließ ich Kälte und Kummer im Mondlicht zurück.
Die Einsicht der Nacht hielt der Prüfung bei Tageslicht stand. Ich korrigiere: Von standhalten kann gar keine Rede sein, denn ihre Wirkung wuchs von Stunde zu Stunde. Im Bestreben, meiner Überzeugung höchstmöglichen Nachdruck zu verleihen, fasste ich den Entschluss, den Richter persönlich aufzusuchen. Bei Gericht fand ich ihn zunächst nicht vor, was weiter nicht verwunderlich war; ich hatte versäumt, einen Termin zu vereinbaren. Ich bat die Sekretärin um telefonische Benachrichtigung, die zwei Tage später tatsächlich erfolgte. Ich eröffnete dem Richter in wenigen Worten, dass ich am Schuldspruch des Mörders meiner Tochter und an der Bestimmung des Strafmaßes lenkend teilzuhaben beabsichtigte. Der Richter schwieg einen Moment, räusperte sich, wie manche Menschen dies unter angestrengtem Nachdenken zu tun pflegen, und entgegnete freundlich, aber bestimmt, dass er um meine emotionale Notlage wisse, mein Anliegen unter menschlichen Aspekten durchaus nachvollziehen könne, dass Privatpersonen das Recht, zu richten, jedoch nicht zustünde, sondern nur dem Staat allein. Er machte sich sogar die Mühe, mir die Grundzüge moderner Rechtsnormen zu erläutern, verwies dabei auf die römische Rechtsordnung um 450 v. Christus und das Zwölftafelgesetz, und erwähnte mehrfach die Constitutio Criminalis Carolina von 1532, das erste deutsche Strafgesetzbuch. Unbeeindruckt von dem rund zwanzigminütigen Vortrag über europäische Rechtsgeschichte, den ich seiner rührenden Absurdität wegen willig über mich ergehen ließ, wiederholte ich mein Anliegen. Hierauf entgegnete der Richter, es sei weder formal noch moralisch rechtens, mich in irgendeiner den Ausgang beeinflussenden Weise am Prozess teilhaben zu lassen. Er könne einen Täter-Opfer-Ausgleich anregen, halte dies aber angesichts meines außergewöhnlichen Verhaltens – in Anspielung auf meine unbelehrbare Starrsinnigkeit – für verfrüht. Ich beendete das Gespräch mit einem freundlichen Dank für die Zeit und Mühe, die er mir hatte zuteilwerden lassen. Schließlich war ich mir darüber im Klaren, dass ich mich andernfalls in eine Position gebracht hätte, die man als befremdlich einordnen musste. Dies lag nicht in meinem Interesse.
Читать дальше