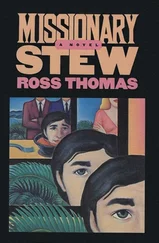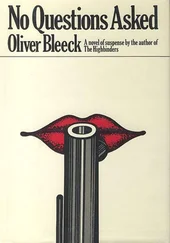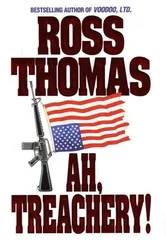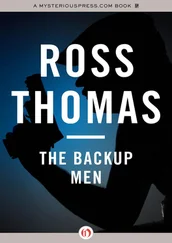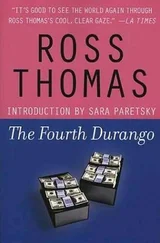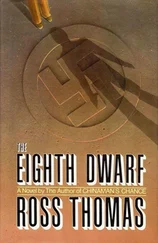1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Thomas Ross
Gelbfieber
Gelbfieber
Thomas Ross
Copyright: © 2018 Thomas Ross
Cover: Thomas Ross
published by: Neopubli GmbH, Berlin
www.neobooks.comISBN 978-3-??
„ Da bisher keine kausale Therapie zur Verfügung steht, sollten exponierte Personen aktiv geimpft werden. Der Impfstoff besteht aus attenuierten Viren und wird i.m. oder s.c. von einem von der WHO dafür autorisierten Arzt appliziert.
Bei Immunsupprimierten ist die Impfung kontraindiziert .“
Groß, U. (2013). Kurzlehrbuch Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie (3. Aufl.). Stuttgart, Thieme: S. 383.
Noch dreihundert Meter. Sie haben Witterung aufgenommen, karminrote Zungen wirbeln rau über geifernde Lefzen, irre Blicke, von Höllenglut entflammt; jetzt explodieren die Kräfte, der Sturm bricht los, die Hetzjagd ist eröffnet. Dort läuft die Beute, sie darf nicht entkommen, aber noch ist der Weg weit; endlich wird der Abstand kürzer, der Geruch von Blut und Sieg liegt in der Luft, stark und unwiderstehlich schön ist der Duft; das Wild aber sprintet in Panik voran, fühllos vor Angst tritt es um sein Leben. Noch immer hält ein kleiner Vorsprung. Hundert Meter jetzt, dann fünfzig, zwanzig. Es zuckt sein Körper wie unter Strom, es fliegt dahin die Meter zum Ziel; ein letzter Blick geht nach hinten fort, und endlich malt sich ein Lächeln in das von Qualen schon grüne Gesicht. Es wird reichen!
Die Meute sieht es, stöhnt, Entsetzen erstickt die Gier; Wölfe im Blutrausch, mit hängenden Köpfen, gedemütigt vom entkommenen Wild, das jetzt die Arme in den hellblauen Himmel reißt. Am Straßenrand erhebt sich Jubel, der ruhmreiche Höhepunkt ist da, sie stehen mit ihm vereint, dem Ersten, dem großen Sieger. Gewonnen!
Jetzt rollt auch der Zweite ins Ziel … der Zweite, der erste Verlierer.
Die Jagd ist zu Ende. Aber scheinbar nur, denn schon kommen Häscher einer anderen Art, es sind Jäger von einer Spezies, die selbst den Triumphator, den stärksten der Starken, zur Strecke bringen. Mikrofone, an Stangen geheftet, stoßen wie pelzbewehrte Schwerter auf das Haupt des Siegers herab, vor und zurück und vor und wieder zurück, immer nach dem großen, ewigen Satz aus dem weißschäumenden Siegermund gierend, einem Mund, der kraftlos um Atem ringt und hustet und keucht, wie von schwerer Krankheit erstickt. Es ist ein Mund, der zu allem in der Lage scheint, nur zum Sprechen nicht.
Eine Kaskade von Fragen stürzt auf den Erschöpften ein, ein Rauschen nur für den, der unter dem kläglichen Beben seiner erschöpften Beine das Fahrrad als Krückstock nutzt. Zwei Männer greifen ihm unter die Arme wie einem gebrechlichen Alten, der sich nach langer Krankheit im Gehen übt. Langsam kehrt Leben in die halbtote Hülle zurück, und aus heiserem Krächzen schälen sich Silben heraus, dann Laute, die sich zu Worten, endlich zu Sätzen formen, und Sätze, die nicht weniger wollen, als uns, den vom Siegerglanz Geblendeten, das Unbegreifliche begreiflich zu machen.
Ja, es war hart, sehr hart, und am Ende so verdammt knapp, aber er sei durchgekommen, sagt der Sieger, am Mont Ventoux habe er gute Beine gehabt, sagt er, doch müsse man sehen, wie es morgen gehe.
Damit hat er alles gesagt. Aber die Schwerter stoßen weiter zu: Wie es sich anfühle, der Moment, wenn die Post abgeht, und was in einem vorgehe, wenn man merkt, dass man Chancen hat? Leere Augen verraten Ratlosigkeit. Der Sieger muss passen, ein Pontifex, der sein Heil in Allgemeinplätzen sucht: Die anderen hätten nicht nachgesetzt, und dann habe er es versucht, mit drei anderen, und am Ende habe er eben die meisten Körner in den Beinen gehabt und so weiter und so fort.
Mittlerweile ist das Heer der Zweiten vom Schauplatz verschwunden. Die Fragen sind beantwortet, nun endlich darf auch der Erste gehen. Der Weg des Siegers führt schnurstracks zur Toilette. Wir nehmen an, er tut dies einem natürlichen Bedürfnis folgend, aber wir täuschen uns. Die Pflicht ruft ihn, denn es gilt herauszufinden, ob der Sieger von heute auch morgen noch siegen darf. Gleich nebenan pinkelt der Mann in Gelb in einen Becher. Ein knapper Gruß, ein verstohlener Blick zur Körpermitte, Kopfnicken und etwas Schulterklopfen, das warʼs.
Zwei Männer und zwei Plastikbecher. Urin. Der Geruch von Ammoniak. Mit diesem Bild soll sie beginnen – die Geschichte von legendären Schlachten und ruhmreichen Kämpfern, von Matadoren, den Helden der modernen Zeit; die Geschichte von Siegern.
Ein großes, hoffnungsvolles Talent! Ben Abraham ist Juniorenweltmeister im Zeitfahren. Der Sächsische Anzeiger wusste es bereits vor langer Zeit: „Von dem dürfen wir viel erwarten. Die großen Rundfahrten rufen, der Vergleich mit den Besten steht an.“
War es diese unscheinbar schlichte, fast schüchterne Notiz, die einen neuen Stern aus der Wiege hob? Man wollte, man musste es einfach glauben. Der Stern schoss zum Himmel und leuchtete von nun an am Firmament der deutschen Sportlandschaft. Hell und klar vergoss er sein Licht über die Welt, und doch wusste niemand, woher der Stern seine Leuchtkraft nahm. Mehr als für die Tatsachen des Aufstiegs, die, für sich genommen, einem glücklichen Gemisch aus Talent und harter Arbeit entsprangen, interessierte man sich für die Begleitumstände. Einige sagten, es müsse am Geburtsjahr liegen (Abraham wurde im Zeichen des Feuer-Hasen geboren). Als nicht minder einflussreich wertete man den Zwillingsmonat Juni, der Tatkraft wegen, die Zwillingsmännern zu eigen ist, ebenso wie nachgerade den Tag sechzehn des besagten Monats, an dem die universale Konstellation sich so günstig fügte, dass dieser Stern geradezu mit Notwendigkeit hatte entstehen müssen.
Zweifel? Aber nicht doch! Auch wennʼs unwahrscheinlich scheint, so könnte es doch wahr sein. Lassen Sie uns in aller Kürze festhalten, dass unser Himmelsbote im Juni 1987 in die Familie eines Elektrofachmeisters im Rostocker Industrieviertel hineingeboren wurde, der in zweiter Ehe mit einer Angestellten des städtischen Wasserwerks verheiratet war, lassen Sie uns dabei nicht verschweigen, dass er mit einer jüngeren Schwester und einem älteren Halbbruder in der kleinen Plattenbauwohnung am nördlichen Stadtrand ein einziges winziges Zimmerchen teilte; dass ihm infolge der bescheidenen räumlichen Verhältnisse wenig mehr als fünf Quadratmeter Territorium blieb, worüber er hoheitlich verfügen konnte. Anders ausgedrückt: Die materiellen Verhältnisse des jungen Hoffnungsträgers waren bescheiden. Man lebte wie viele andere Familien in Deutschland, man lebte durchschnittlich. Durchschnittlich, was Vergangenheit, durchschnittlich, was Gegenwart, und durchschnittlich, was Zukunftsperspektiven betraf. 550 Mal Zähneputzen, 2.500 Stunden Schlaf, 220 Arbeitstage, zehn Haarschnitte und 110 Mal durchschnittlichen Sex im Jahr – das Einzige, was nicht in einem Atemzug mit dieser farblosen Durchschnittlichkeit genannt werden kann, ist die Neigung der Mutter zu einer das übliche Maß deutlich übersteigenden körperlichen Aktivität.
Читать дальше