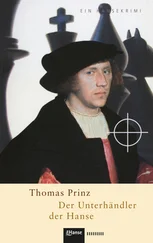Vor allem aber lernte ich Natalie kennen. Sie hatte Tiermedizin studiert, weil sie Tiere gerne mochte und es unerträglich fand, dass man ihrem Wohlergehen so wenig Wert beimaß, wo sie als Nutztiere und beste Freunde uns Menschen doch seit Jahrtausenden unschätzbare Dienste leisteten.
Für all das interessierte ich mich herzlich wenig, ließ mir aber nicht gleich in die Karten schauen, denn ich fand sie ganz reizend, auf eine klassische Weise schön und begehrenswert. Ihre dunklen Mandelaugen bezauberten mich über die Maßen, der süße Duft ihrer kastanienbraunen Haare ließ mich vor Liebe erzittern, und schon konnte ich von diesem Duft nicht genug bekommen und von dem Zauber, diesem endlosen Glück in ihrer Nähe.
Nach zwei Jahren gegenseitiger Erprobung traten wir vor den Traualtar. Ein Jahr später kam unsere Tochter zur Welt, Carolina.
Die Geburt des Mädchens läutete eine neue Epoche ein.
Es gibt so etwas wie einen Hang, die Nachkommen zu glorifizieren, und nicht selten kann man beobachten, wie verklärte Seligkeit Besitz von jungen Eltern ergreift, kaum dass von ihren Kindern die Rede ist. Derartige Gefühlsduseleien hatten in meinem Verhalten freilich keinen Platz. Ich fand das schlichtweg albern und hatte das auch immer laut gesagt, was mir einen schlechten Ruf einbrachte und schließlich, als ich selbst an der Reihe war, das Gespött meiner Mitmenschen. Denn mit dem Erwachen der ersten Charakterzüge meines Kindes war es um mein objektives Urteil geschehen. Von nun an leuchteten die Sterne, Entrückung brach sich Bahn und die objektive Realität verblasste in fast biblischer Verklärung. Über das Wesen meines Kindes philosophierend brachte ich zu jeder sich bietenden Gelegenheit Allgemeinplätze vor, getragen vom Pathos der Liebe, eine Projektion alles denkbar Guten. Ein Arsenal positiv besetzter Adjektive verband ich mit ihr: süß, lieb, lustig, herzlich und von reiner Unschuld sei sie, frei von Verschlagenheit, Falschheit und Hinterlist. Weniger erbauliche Wahrheiten, die nicht selten zutage traten, wenn sie müde und hungrig sich bisweilen wie eine Furie aufführte und mich mit unbändigem Zorn an den Rand der Verzweiflung trieb, hielt ich in den hinteren Winkeln meiner Seele unter Verschluss – so wie die meisten Eltern es tun. Im Sinne des Fortbestandes der eigenen Gene sieht man seinen Nachkommen so manche Unliebsamkeit, so manche Zeiten der Entbehrung und Entsagung milde nach. Und das ist auch gut so.
Doch hätte ich damals, noch vor wenigen Wochen, all dies offen und frei und ohne Scham zu sagen vermocht? Dass die objektive Wahrheit zeitweise hinter der subjektiven zurückstehen müsse, weil das Leben es eben so will? Hatte ich nicht eben noch, meine wahren Gefühle ignorierend, eitel und selbstgefällig in die Welt hinaus posaunt, all dies sei barer Unsinn?
Nun, ich habe es getan, in unentschuldbarer Verkennung des wahren Wesens der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern habe ich es getan. Den furchtbaren Irrtum erkannte ich erst, als etwas schiefgegangen war, als das Schicksal den Grundplan der Natur durchkreuzt hatte. Nie habe ich den unermesslichen Raum, der sich im gemeinsamen Erleben von Beziehung mit meiner Tochter aufspannte, besser und tiefer und schmerzlicher verstanden als an jenem Tag, als alles zu Ende war. Ich habe erst begriffen, als es bereits zu spät war.
An 31. März war Carolina nicht von der Schule nach Hause gekommen. Natalie hatte sie wie immer um halb zwei zum Mittagessen erwartet. Carolina hatte sich nie nennenswert verspätet, das war nicht ihre Art. Bereits im Kindergarten war ihre Vorliebe für Uhren zu Tage getreten, besonders das Ticken unserer Wanduhr hatte es ihr angetan. Verplapperte sie sich nach dem Unterricht doch einmal, so ging sie eben schneller nach Hause, ja rannte mitunter in vollem Lauf. Und wenn das Laufen nicht mehr half, bat sie um Mitfahrt im Auto einer Freundin, die abgeholt wurde. Kurzum, man konnte sich darauf verlassen, dass ihr selbst in widrigen Situationen noch etwas einfallen würde, um die elterlichen Erwartungen zu erfüllen. Umso verstörender war es, dass sie an diesem Tag nicht zur gewohnten Zeit am Mittagstisch erschien. Natalie rief mich gegen zwei Uhr im Büro an. Augenblicklich spürte ich ein heftiges Ziehen in der Brust. Ich suchte nach Erklärungen für das Ausbleiben des Kindes und klang dabei so armselig, dass Natalie umgehend in Tränen ausbrach. War es meine Atemnot oder ihr Schluchzen, was mich zum Handeln bewegte? Ich erinnere es nicht mehr. Irgendwann rief ich die Polizei an und forderte die Veröffentlichung einer Vermisstenmeldung.
Ein teilnahmsloser Beamter gab mir mit gekünstelter Freundlichkeit zu bedenken, dass eine Stunde Verspätung kein hinreichender Grund für eine so weitreichende polizeiliche Maßnahme sei. Es fiel mir schwer, diesem Menschen nicht lautstark die Pest an den Hals zu wünschen, doch ein Mangel an Respekt wäre in dieser Situation nicht hilfreich gewesen. Also nahm ich mich zusammen und legte dem Beamten dar, dass Carolinas Stunde nicht mit einer Stunde gleichzusetzen sei, die irgendein beliebiger Mensch sich verspätet haben mochte. Ob es mir gelang, den Mann zu überzeugen, ist fraglich, denn das Argument der Gleichwertigkeit einer Stunde von Carolina mit einem Tag für den Rest der Welt hielt ich selbst für überzogen. Nach einer Weile heftigen Zuredens gab der Beamte jedoch nach und beendete das Gespräch mit dem Versprechen, sich um den Fall zu kümmern. Er werde zusehen, was er tun könne.
Was mit Worten nicht gesagt werden kann, wird gemeinhin in Bilder gefasst. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, diese Bilder zu entschlüsseln. Werden sie dem Abgleich mit der Realität standhalten? Werden sie vergehen, wenn ich sie berühre, im Nichts zerfließen wie die flüchtigen Schatten unserer Träume? Ich weiß es nicht, weil ich gar nichts mehr weiß. In meinem Inneren sehe sich das Bild und nichts weiter, das schreckliche Bild eines Albtraums, dessen ich nicht habhaft werden kann; ich sehe in die Tiefe und finde die existenzielle Verlorenheit in einem grenzenlosen Schrecken.
Die Tage nach Carolinas Verschwinden waren ein Albtraum ganz in diesem Sinne, ein Zerrbild, von dem wir uns durch rationales Denken, durch die konsequente Analyse des Möglichen und Ausschluss des Unmöglichen nicht freizumachen wussten. Es war ein Albtraum ohne das Bewusstsein des nächsten Morgens, ohne den süßen Nachgeschmack einer überwundenen Erinnerung, es war der gelebte Horror einer erbarmungslosen Wirklichkeit, die grausam und unerbittlich jede Hoffnung im Keim erstickt. Angst und Bangigkeit wuchsen zu einer gewaltigen Bedrohung, die selbst meine jahrzehntelang trainierte Urteilskraft kapitulieren ließ.
Gesegnet sind jene, dachte ich damals, die im Spiegel des Grauens den Verstand verlieren, die sich dem Wahnsinn anheimgeben, wenn der Schrecken den Schutzwall der Seele überwunden und die heilenden Kräfte des Ausgleichs, der Ruhe und der Versöhnung vernichtet hat!
Aber weder Natalie noch ich nahmen diesen Ausweg. Stattdessen stellten wir uns dem ungleichen Kampf, wie David dem Goliath, freilich mit dem Unterschied, dass uns der rettende Steinwurf versagt blieb. Wir kämpften in der furchtbaren Gewissheit, dass die Hoffnung nur ein Trugbild war, eine Fata Morgana, ein Gauklerstück des Geistes, vorgetragen von einem sterbenden Ich. Das Leben an der Grenze des Erträglichen ist nicht lang, und ich habe es verloren, als unsere Tochter an einem Waldparkplatz in der Nähe von Konstanz tot aufgefunden wurde.
Es war neun Tage nach ihrem Verschwinden, dass man Carolina fand. Sie trug ein gelb gestreiftes, über und über mit Frühlingsblumen: Tulpen, Narzissen und Vergissmeinnicht, besticktes Kleid. Die Blumen waren noch frisch und mit großer Sorgfalt auf den Stoff genäht worden. Benachbarte waren nie von derselben Art, sodass sich ein Muster an Farben und Formen ergab, das dem Lichterspiel der Sonnenstrahlen auf dem Waldboden ähnelte. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz aus Tannenreisig, an dessen Oberseite elf Rosen, zehn weiße und eine rote, angebracht waren. Die Stichwunde in der Brust war medizinisch behandelt worden. Wie sich später herausstellte, hatte der Mörder Carolina das Kleid post mortem übergezogen und ihr die Wunde, die von sechs Sumpf-Schwertlilienblättern kreisförmig eingefasst war, nachträglich zugefügt. Das Kleid verströmte einen Hauch von Lavendel, vor den sich andere natürliche Düfte setzten, als sei es in ein Bad natürlicher Blütenessenzen gegeben worden. Die Schuhe waren auffallend sauber, sie glänzten selbst an den Sohlen, woraus man entnahm, dass Carolina nicht mehr gelebt haben konnte, als sie in den Wald gebracht wurde. Spuren sexueller Gewaltanwendung wurden nicht gefunden, dennoch ging man von einem sexuellen Tatmotiv aus. Carolina lag in eine Mulde gebettet, die mit gelben, grünen und roten Eichenblättern ausgelegt war, die der Täter bereits im vergangenen Herbst gesammelt und chemisch konserviert haben musste.
Читать дальше