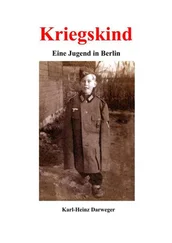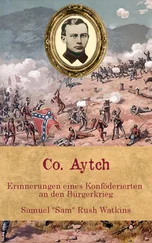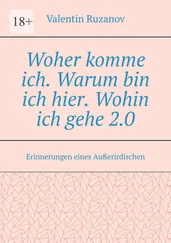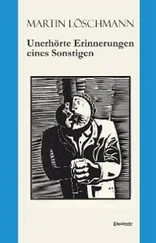Dieses Gefühl der Nähe und der Ungeteiltheit der Existenz hatte ich im Verhältnis zu meiner Mutter nie. Vor allem weil sie, mit Ljusja und später mit den anderen Kindern beschäftigt, sich wenig um mich kümmerte. Zurückhaltend, verschlossen, von stolzer Scheu in der Äußerung ihrer Gefühle, versteckte sie sich seit meiner frühesten Kindheit übertrieben schamhaft vor mir – von meinen ersten bewußten Tagen an war sie für mich, wenn sie stillte und schwanger war, ein ganz besonderes Wesen, gleichsam der lebendige Inbegriff der Natur, die nährte, gebar, sorgte und zugleich fern und unnahbar war.
Dieser Eindruck von der Mutter als der Mutter Natur wurde durch den Kult meines Vaters noch verstärkt, der meine Mutter seinem Gefühl nach und aus bewußter Überzeugung verehrte, ohnehin hielt er die Frau und Gattin für ein besonderes Wesen und seine Frau für ein dreimal so besonderes, was im übrigen höchstwahrscheinlich nicht unberechtigt war. Für mich hatte sie kein Gesicht: Sie umgab unser Dasein ganz, man spürte sie überall, und doch war sie irgendwie unsichtbar. Von meinem Vater, von Tante Julia, meinen Brüdern und Schwestern und Tanten und Cousins und Cousinen wußte ich zu erzählen, aber von meiner Mutter habe ich früher fast nichts sagen können; und auch jetzt kann ich wenig von ihr sagen, nur, was andere mir von ihr erzählt haben, eigenes nicht. Mit meiner Analyse komme ich dem amorphen, obwohl sehr starken Eindruck, den meine Mutter hinterließ, nicht bei, er läßt sich nicht objektivieren, nicht in Worte fassen. Mit meinem Vater habe ich mich immer viel unterhalten; mit Tante Julia und den anderen Tanten und mit allen sonst auch. Aber mit meiner Mutter wohl nie, oder es ist der Eindruck entstanden, ich hätte mich mit ihr nie unterhalten. Mein Verhältnis zu ihr bedenkend, komme ich mir vor wie ein einsamer Pilger in einem großen kühlen Hain. Heiliger Schauer und Schweigen, Kühle und Scheu ... nicht Furcht, aber ...
Die Mutter war für mich wie die vertraute Tiefe des Seins, aber sich an sie zu schmiegen wie an ein Vertrautes, wäre seltsam fremd und unpassend gewesen. Natürlich ist das übertrieben. Natürlich habe ich mich an sie geschmiegt, sie geküßt, aber ich weiß genau, daß sie diese Liebkosungen mit jedem Jahr kühler und verlegener aufnahm, und ich spürte, daß ich da gewisse Grenzen verletzte. Ich war, das muß ich sagen, ein sehr zärtliches Kind, dauernd küßte ich bald den einen, bald den anderen, ich bedurfte dieser Liebkosungen wie der Luft, der Wärme und des Lichts. Ich entsinne mich, wie meine Mutter oder Tante Lisa meiner Frau Anna später erzählte, daß man mich ungewöhnlich leicht der Brust entwöhnt hätte: Ich hätte es gar nicht gemerkt. Und eine ganz schwache Erinnerung bestätigt mir diese Erzählung: Ich war nicht sehr begierig, gesäugt zu werden, um nicht zu sagen, ich stieß die Brust zurück; und deshalb fiel ich bei der ersten Gelegenheit von ihr ab, wie wenn die Flüssigkeit, die zwei Blätter Papier aneinanderklebt, ausgetrocknet ist. Ich fiel ab von der Brust und merkte es nicht, d.h. ich bin mit der Brust nie verbunden gewesen. Wie das meiner unmittelbaren Erinnerung an diese ersten Ereignisse gleicht. Und das ist umso charakteristischer für mich, als ich, um es zu wiederholen, ein ungewöhnlich zärtliches, ungewöhnlich anhängliches Kind war und jeder Liebe mit meinem ganzen Wesen hingegeben.
Wenn sogar die Brust der Mutter mein Herz nicht zu sich hinzog, wenn mit der Brust der Mutter nicht etwas meinem Herzen Allernächstes aus meiner Seele gerissen wurde und mit ihm die Seele selber zerriß, dann heißt das – das muß ich hier entschieden erklären –, daß ich von Anfang an diese Bindung an die Mutter nicht gehabt habe, diese Bindung des Sohnes, die jedes Kind normalerweise hat. Diese Bindung hatte ich zu Tante Julia. Ich will damit nicht sagen, daß ich überhaupt keine Beziehung zu meiner Mutter hatte. Im Gegenteil, sie war außerordentlich stark. Aber sie war nicht persönlich, sie war eher pantheistischer als sittlicher Art.
In der Mutter liebte ich die Natur oder in der Natur die Mutter, Spinozas natura naturans [die schaffende Natur]. Ich wußte, meine Mutter liebt mich sehr, gleichzeitig hatte ich immer das Empfinden geheimnisvoller Hoheit. Und mir schien, daß sie sich einmal zu ihrer ganzen Größe erheben und mich, es nicht bemerkend, erdrücken könnte. Ich hatte davor keine Angst und hätte mich dagegen nicht gewehrt. Aber das schuf eine Distanz, von der in dem Verhältnis zu meinem Vater oder zu meiner Tante keine Rede sein konnte.
Meine Tante war der andere Pol meiner Kinderzeit. In ihr leugnete ich nicht die noumenale Macht, ich begegnete ihr nicht mit Staunen, sondern liebte sie mit einer tief persönlichen Liebe, ich war wahrscheinlich mit dem ganzen keuschen Gefühl des Kindes in sie verliebt. Sie war für mich Freund, Kamerad und Lehrer, mit ihr teilte ich meine Freuden und Leiden; sie schimpfte mit mir und bestrafte mich (obwohl das selten vorkam), wie sie überhaupt alles Menschliche verkörperte. Sie erdrückte mich nicht mit ihrer Abgelöstheit von den Kleinigkeiten des Alltags; man konnte sich mit ihr über schicke Kleider, über Spitzen, Bänder und Hüte unterhalten, was ich für mein Leben gern tat; mit ihr pflückte ich Blumen und machte Sträuße, und überhaupt, mit ihr konnte man leben. Meine Mutter mußte man verehren. Nicht weil sie es verlangte. Im Gegenteil, nichts, wenn man es von der bewußten Überzeugung her nahm, war meiner Mutter so fremd wie der Anspruch auf Beachtung oder ähnliches. Sie litt unter jeder Art Beachtung, die ihre Bescheidenheit und Schüchternheit so sehr steigerte, daß sie gar nicht mehr in Gesellschaft von Menschen leben konnte... Und trotzdem, ja vielleicht gerade deswegen, warum sie eine Atmosphäre, die Verehrung verlangte, nicht Leben.
Meine Schwester Ljusja wurde geboren, als ich schon 2 ½ Jahre alt war. Aber weder Ljusjas Geburt noch ihre ersten Lebensjahre haben eine Spur in meinem Gedächtnis hinterlassen. Ich erinnere mich dunkel, daß Papa mich eines Tages auf den Arm nahm und mir die Geburt meiner Schwester mitteilte. Als ganz schwacher Eindruck ist mir geblieben, daß er sehr zufrieden war und mir diese Familienneuigkeit erfreut mitteilte, das muß im Eßzimmer gewesen sein.
Aber als etwas Bedeutsames habe ich es nicht empfunden, und an die neugeborene Ljusja erinnere ich mich überhaupt nicht. Mir ist so, als hätte man mich zu Mama geführt und sie hätte ganz in Weiß dagelegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht Ljusjas Geburt mit der Geburt eines der nächsten Kinder durcheinanderbringe. Auch von der Taufe, mit der sie Tante Julia zu Ehren Ljusja (Abkürzung von Julia) genannt wurde, habe ich nichts behalten.
Ein Ereignis unserer ersten Lebensjahre aber hat sich mir fest eingeprägt. Die Pockenimpfung von mir und Ljusja. Ich weiß noch ganz genau, daß bei uns wiederholt von der Notwendigkeit der Impfung gesprochen wurde. Doch die Impfung verzögerte sich Tag um Tag, wahrscheinlich weil man lange keinen frischen Impfstoff bekam. Ich zitterte die ganze Zeit vor diesem unbekannten Schrecknis und hoffte insgeheim, daß alles immer weiter hinausgeschoben und schließlich vergessen werden würde. Tatsächlich hörten die Gespräche über die Impfung auf, vielleicht weil man bemerkt hatte, daß sie einen so starken Eindruck auf mich machten. Und ich hatte mich beinahe beruhigt.
Einmal saß ich auf einer kleinen Bank in der Nähe des Hauses. Jemand saß neben mir, wahrscheinlich einer meiner Cousins, Datiko (David Sergejewitsch Melik-Begljarow) oder Sandra (Alexander Stepanowitsch Tschrelajew). Wahrscheinlich ging es auf den Abend zu. Da kommt ein Mann die Straße entlang. Sofort fing mein Herz wild an zu schlagen, als spürte es irgendeine Gefahr, eine mir zwar unbekannte Gefahr, die mir aber umso schrecklicher vorkam. Als er uns erreicht hatte, fragte er, ob Florenskis hier wohnten, vielleicht bat er auch auszurichten, der Feldscher sei gekommen. Blitzschnell und wie von Sinnen rannte ich nach Haus und stürzte durch die halboffene Tür, nicht so sehr, um den Auftrag zu erfüllen, als vielmehr um dem bösen Mann zu entfliehen.
Читать дальше