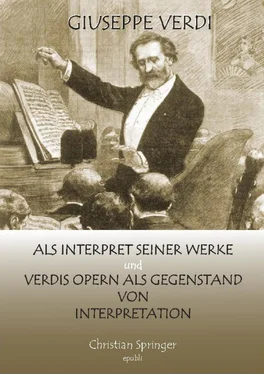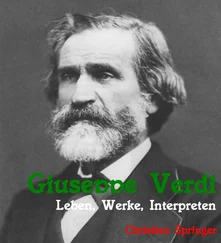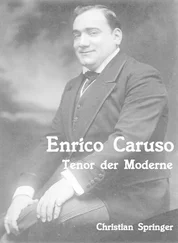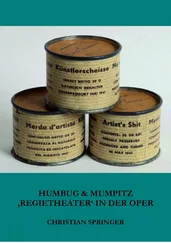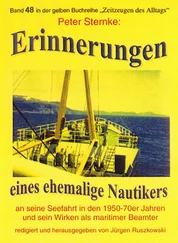3. Gegen die Zusammensetzung und die Anordnung der Orchester, die überall mehr oder weniger miserabel ist. Ihr führt als Vorbild die Opéra-Comique an. Doch warum 10 Erste Geigen und 8 Zweite?{11}
Die Themen, die Verdi in diesem Brief anspricht – Autorenwille und dessen Missachtung, Interpretenwillkür, Text- und Notentreue, Interpretenhandwerk, eingebürgerte Traditionen – sind die Themen der vorliegenden Betrachtung.
„Was ermöglicht dem Kunstwerke zu existieren, was verbürgt ihm seine Dieselbigkeit, wenn es gerade weder ausgeführt noch gehört wird? Was erlaubt ihm, sich als dasselbe in verschiedenen Ausführungen zu zeigen?“ fragte der bedeutende polnische Philosoph Roman Ingarden (Krakau 1893-1970), nicht ohne bewusst mit dem Begriff „Ausführung“ den in romanischen Sprachen gängigen Terminus „esecuzione“ bzw. „exécution“ zu verwenden und dabei das höher greifende deutsche Wort „Interpretation“ zu vermeiden. Dieser deutsche Begriff wurde bereits im 19. Jahrhundert auf herausragende Interpreten von Musikwerken wie Clara Schumann, Franz Liszt oder Anton Rubinstein angewandt, als Synonym für die Aufführung bzw. Ausführung von Musik setzte er sich allgemein aber erst im 20. Jahrhundert durch. „Das Bewusstsein für die konstitutive Interpretationsbedürftigkeit komponierter Musik ist also verhältnismäßig jung“, stellt der Schweizer Musikwissenschafter Hans-Joachim Hinrichsen{12} fest, womit er einen Gedanken anspricht, den Sergiu Celibidache gerne so formulierte: „Musik als solche existiert nicht. Sie entsteht erst bei der Aufführung“, was nichts anderes bedeutet, als dass ein Musikwerk in der notierten Partitur nur ein „schematisches Gebilde“ (Ingarden) ist, das „erst in der Reihe seiner Aufführungen zur lebendigen Konkretion und gerade damit zu seiner Identität“ (Hinrichsen) gelangt.
Einen essentiellen Beitrag zur Etablierung der Interpretationsforschung als Teildisziplin der Musikwissenschaft leistete der 1992 von Hermann Danuser herausgegebene Band über die Interpretation innerhalb des Neuen Handbuches der Musikwissenschaft{13}, der mit dem neuen Titel „Musikalische Interpretation“ den alten Titel „Aufführungspraxis“ (Ausgabe 1929) ersetzt.
Der Begriff „Interpretation“, wie er in der vorliegenden Betrachtung verwendet wird, ist allerdings einzuschränken. Von den drei von der Musikwissenschaft (Danuser) unterschiedenen, jedoch ineinanderfließenden Zeithorizonten der Interpretation von Musikwerken
1 die vom Komponisten selbst vorgesehene Weise der Darstellung,
2 die musikalische Tradition, von der sich ein gegenwärtiges Bewußtsein getragen fühlt,
3 die jeweilige Gegenwart{14}
wird hier im wesentlichen nur der erste betrachtet.
Auf die drei Modi der Interpretation
1 historisch-rekonstruktiver Modus,
2 traditioneller Modus,
3 aktualisierender Modus{15}
braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden, da die verschiedenen Aspekte der Interpretation von Verdis Bühnenwerken ausschließlich in jener Form beschrieben werden, in der sie in Äußerungen und Wünschen des Komponisten über sie und zu ihnen überliefert sind.
Auch der etwas unscharfe Begriff der „Intentionen“ des Komponisten bedarf der Definition. Es werden hier – ohne daß auf die musikwissenschaftlich-semantisch nicht unumstrittenen Begriffe „Autorintention“ und „auktoriale Aufführungstradition“{16} näher eingegangen werden muß – zwei Arten von Komponistenintentionen unterschieden, wie sie von Giuseppe Verdi selbst geäußert wurden: Erstens die Interpretationsanweisungen in seinen Partituren, die eine authentische Reproduktionsweise der Kompositionen zu Verdis Lebzeiten im Zeitraum zwischen 1840 und 1900 (wie auch in der Zukunft) gewährleisten sollten; zweitens die in Briefen und sonstigen Dokumenten, aber auch mündlich überlieferten Anweisungen und Kommentare des Komponisten, die eine Aufführungstradition begründen sollten, welche seinen Vorstellungen entsprach.
Aber weder die Interpretationsanweisungen in den Partituren noch die Vielzahl von Dokumenten und sonstigen überlieferten Äußerungen Verdis zur Aufführung seiner Werke helfen über alle offenen Fragen hinweg, und zwar aus zwei Gründen:
Erstens: Verdi war kein Theoretiker der Musikästhetik („Nein, nein, sprechen Sie nicht von großem Musiker. Ich bin ein Mann des Theaters“{17}), sondern zog es allzeit vor, Musik zu komponieren und diese für sich selbst sprechen zu lassen, anstatt sich theoretisch in Schriften, Vorträgen, Lesungen oder Pamphleten über sie, ihre Entstehung oder seine Intentionen zu verbreitern (wie dies z.B. sein Kollege Richard Wagner gerne und ausführlich tat). Die mehr theaterpraktischen als theoretisch-abstrakten Äußerungen zur Interpretation seiner Werke müssen somit aus Verdis umfangreicher Korrespondenz herausgefiltert und erläutert werden.
Zweitens: Die in den Partituren enthaltenen Vortragsanweisungen des Komponisten waren einzig und allein an zeitgenössische Interpreten gerichtet, die ein aufführungspraktisches Wissen besaßen, wie es zu der Zeit gelehrt und praktiziert wurde. In den Jahrzehnten nach Verdis Tod veränderte sich dieses Wissen zu einem Teil, zum anderen ging es verloren. Am deutlichsten zeigte sich dies, als die Interpreten der Verismo-Opern Giordanos, Mascagnis, Leoncavallos, Tascas usw. ihre naturalistische Schreidramatik mit der daraus resultierenden Verplumpung und Verrohung des sängerischen und interpretatorischen Instrumentariums auch auf ältere Musik (nicht nur auf Verdi) übertrugen, wenn also die Interpreten von Rigoletto, Nemorino, Almaviva oder Norma mit dem vokalen Gestus und dem Interpretationsstil von Compar Alfio, Canio, Loris oder Santuzza agierten. Dieses Phänomen zeichnet sich bereits beim Vergleich der Aufnahmen von authentischen, d.h. von Verdi persönlich instruierten älteren Verdi-Sängern (Adelina Patti, Francesco Tamagno, Victor Maurel) mit Aufnahmen von Verdi-Sängern der nächsten Generation (Adelina Stehle, Edoardo Garbin) und deren Nachfolgern ab, in späteren Jahrzehnten verstärkt es sich zusehends.
AUFFÜHRUNGSANWEISUNGEN, MISSVERSTÄNDNISSE UND UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN
Interpretationsanweisungen sind im Laufe der Musikgeschichte generell von einer gewissen Unschärfe gekennzeichnet. Ihre Bedeutung ist einem ständigen Wandel unterworfen. Um nur ein Beispiel von vielen herauszugreifen: Die Tempobezeichnung Andante (ital. „gehend“) hat im 18. Jahrhundert ein schnelleres Tempo bezeichnet als im 19. Jahrhundert, was nicht von allen Interpreten berücksichtigt wird. Abgesehen von der langsam schreitenden oder etwas lebhafter gehenden Bewegung der Zählzeiten ist für den Eindruck des Zeitmaßes auch der Rhythmus von Bedeutung, der eine „gehende“ Empfindung der Unterteilungswerte (z.B. die Achtelnoten eines 4/4-Taktes) zulässt.
Ungeachtet der sich im Laufe der Zeit wandelnden Interpretationsanweisungen können Mißverständnisse auch aufgrund sich verändernder sprachlicher Voraussetzungen zustandekommen. Das zeigt folgendes Beispiel{18}: Wenn Schubert die Tempobezeichnung „ziemlich langsam“ angibt, verstehen heutige Interpreten das zumeist als „recht langsam“. Das angeschlagene Tempo ist also meist „langsamer als langsam“. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte „ziemlich“ aber die Bedeutung „geziemend“, „angemessen“, „gebührend“, was bei der Tempobezeichnung „ziemlich langsam“ nichts anderes als „schneller als langsam“ oder „etwas langsam“ bedeutet. Wenn Schubert mit „langsam“ überschriebene Stellen metronomisierte, bezeichnete er sie mit Metronomzahlen zwischen 50 und 54, „ziemlich langsam“ hingegen mit 63–66. Dasselbe gilt für „ziemlich schnell“, was eben auch nur „etwas schnell“ oder „langsamer als schnell“ bedeutet. Interessant ist, daß italienische Musiker die deutschsprachige Anweisung „ziemlich“ generell mit „un poco“ übersetzen und somit den Intentionen Schuberts näherkommen als Musiker mit deutscher Muttersprache, die die Anweisungen nach modernem Sprachverständnis deuten. Der Unterschied, den Schubert zwischen „schnell“ und „geschwind“ macht, sei hier nur am Rande erwähnt.{19}
Читать дальше