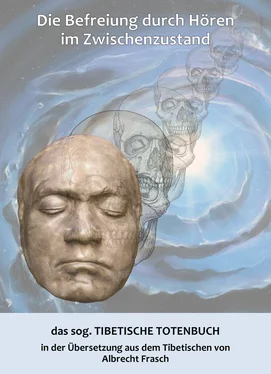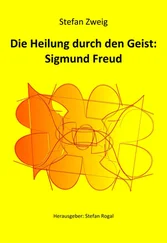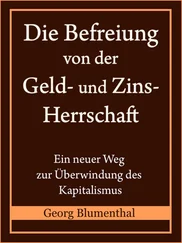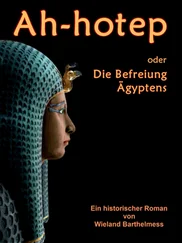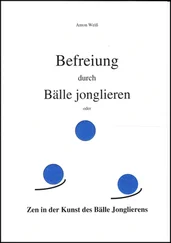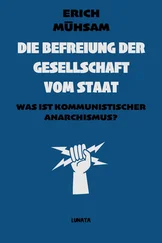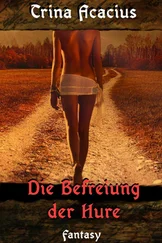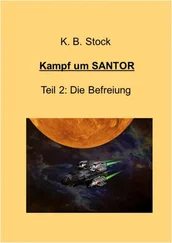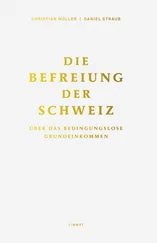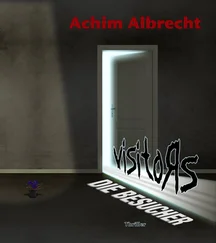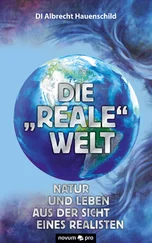Wer unvorbereitet stirbt, kann die weitere Entwicklung nicht beeinflussen, die sein ‚Bewusstseinsprinzip‘ (7) nehmen wird. Wessen unpersönliches Bewusstseinsprinzip dementsprechend blind durch das Roulette der Wiederverkörperungen stürzt (8), der kann weder steuern, wiederum in einer menschliche Existenz – allerdings mit Anlagen zu einer ‚neuen‘ Persönlichkeit ausgestattet – noch in einer glücklichen Existenz wiederverkörpert zu werden.
Die Lehren des Tibetischen Buddhismus ermöglichen es, nahestehende Personen auf ihr Sterben und die Zeit danach vorzubereiten. Da natürlich auch die eigene Existenz zeitlich begrenzt ist, gebietet es die Klugheit, sich auf das Sterben vorzubereiten, solange man noch jung und in guter körperlicher wie geistiger Verfassung ist. Die Vorbereitung auf das eigene Sterben ist selbstredend umso effektiver, je früher man damit beginnt! Doch auch denjenigen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, verhilft das Studium des vorliegenden Textes dazu, den Rest ihres Lebens so sinnvoll wie möglich zu nutzen und ihr Sterben in einer ausserordentlich positiven Weise zu beeinflussen. Darüberhinaus gestatten es die in diesem Buch wiedergegebenen Lehren, vertrauten Menschen beim Vorgang des Sterbens überaus effektiv zu assistieren, auch wenn jene sich nicht auf diesen Vorgang vorbereitet konnten.
Dieser Text, dessen Titel – wörtlich übersetzt – nicht ›Tibetisches Totenbuch‹, sondern ›Befreiung durch Hören im Zwischenzustand‹ lautet, entstammt einem Zyklus von sechs solchen Texten (9), der auf den zweiten Buddha Padmasambhava ( skrt; tib: Guru Rinpoche ) zurückgeht. Der grosse Heilige Padmasambhava verbarg jene Texte als sog. ‚Schatztexte‘ ( tib: gter ma; sprich: Terma ) beim Berg Gampodar in Zentraltibet, wo sie Jahrhunderte später (10) von Karma Lingpa wiedergefunden wurden, der sie an den dreizehnten Gyalwa Karmapa Düdül Dorje weitergab, woraufhin sie sich innerhalb der Nyingma- und Kagyü-Tradition des Tibetischen Buddhismus weithin Verbreitung fanden.
Obschon die erstmalige Übersetzung des vorliegenden Textes ein eklatantes Interesse am Buddhismus tibetischer Prägung im Westen auslöste, sind ihr eine Vielzahl von Unzulänglichkeiten anzulasten: Da bis dato keine Schriften religiösen bzw. philosophischen Inhalts aus dem Tibetischen in moderne Sprachen übersetzt worden waren, fehlte ein Begriffssystem, in das jene hätten übertragen werden können. Weil ausserdem die Wörterbücher, die zwischen Tibetisch und den modernen Sprachen vermitteln sollten, auf Versionen zurückgingen, die im siebzehnten Jahrhundert von Jesuitenpatern angefertigt worden waren, lag es nahe, dieser ersten Übersetzung eine christliche Terminologie zugrundezulegen; dadurch wurde ihr Inhalt natürlich in einer äusserst fragwürdigen Weise verfremdet. Obwohl dieser ersten Übersetzung der ‚Pioniercharakter‘ in keiner Weise abzusprechen ist, ist sie heute – ausser als Arbeitsgrundlage für den vergleichenden Religionswissenschaftler – von keinerlei Bedeutung mehr.
Neuere Übersetzungen des vorliegenden Textes ins Deutsche greifen leider auf jene erste Übersetzung zurück, so dass deren Fehler und Unzulänglichkeiten von Version zu Version weitergetragen wurden. Der Begriff ‚Mitgefühl‘ ( tib: snying rje ) beispielsweise, der im Tibetischen Buddhismus als der aufrichtig empfundene Wunsch definiert ist, alle Wesen frei von sämtlichen Arten des Leidens sowie von dessen Ursachen (11) sehen zu wollen, wird in den verschiedenen deutschsprachigen Übersetzungen des ›Tibetischen Totenbuches‹ als Erbarmen , Gnade oder gar als Mitleid übersetzt. Diese Termini transportieren fraglos vollkommen abwegige und irreführende Konnotationen, vergleicht man ihren Bedeutungsgehalt und ihre übliche Verwendung in christlichen Schriften mit der hier präsentierten Begriffsdefinition. Der für den Buddhismus überaus zentrale Begriff ‚Liebe‘ ( tib: byams pa ) wird ebenfalls in den verfügbaren deutschsprachigen Übersetzungen fernab seiner per Definition festgelegten Bedeutung übersetzt: Was als ‚der aufrichtig empfundene und permanent kultivierte Wunsch, dass alle Wesen – einschliesslich der eigenen Widersacher, Schädiger usw. – immer Glück und die Ursache des Glücks erleben sollen‘ definiert ist, erscheint in den bisher in deutscher Sprache verfügbaren Übersetzungen als Freundlichkeit , tugendhafte Handlung oder als Frömmigkeit . Auch die ‚negative Handlung‘ (12) ( tib: sgrib pa ) wird leider in sämtlichen in deutscher Sprache verfügbaren Übersetzungen – auch wenn die Bedeutung dieses Begriffs weit an obiger Begriffsdefinition vorbeigeht – als Sünde übersetzt (13). Geistige Aktivität bzw. die sog. ‚Mentalfaktoren‘ (14) ( tib: sems dbyungs ) wird in den verfügbaren deutschsprachigen Übersetzungen als Gesamtheit des Wollens , als Gemütskräfte oder Geistesregung übersetzt. Der Meditationsaspekt bzw. die Yidam-Gottheit (15) Chenrezig wird in einer der vorliegenden Übersetzungen als barmherziger Gott übersetzt, womit die vollkommen unzutreffende Implikation eines Schöpfergottes im Tibetischen Buddhismus einhergeht. Doch es bleibt nicht bei diesen willkürlich herausgegriffenen irreführenden Übertragungen tibetischer Termini Technici ins Deutsche: Durchweg benutzt jede Übersetzung eigene, teilweise oder durchgängig einem anderem Religionsverständnis entstammende Begrifflichkeiten, die dem Gegenstand nur sehr unzulänglich gerecht werden bzw. ihm ganz und gar zuwiderlaufen.
Durch eine Terminologie, die die Aussagen des ursprünglichen Textes dermassen verfremdet, werden die Aussagen des ›Tibetischen Totenbuches‹ natürlich weitestgehend verzerrt. Deshalb ist es auch dessen frühen Übersetzungen anzulasten, dass sich selbst heute noch im Westen viele abstruse Vorstellungen über die zentralen Aussagen des Tibetischen Buddhismus hartnäckig am Leben erhalten (16). Da sich die Liste der vollkommen an den Aussagen des Urtextes vorbeigehenden sachlich falschen oder zumindestens weitgehend irreführenden Begriffsübertragungen beliebig fortsetzen liesse (17), sind die drei ‚älteren Übersetzungen‘ für praktizierende Buddhisten leider nahezu unbrauchbar. Es liegt an diesen und anderen Unzulänglichkeiten der verschiedenen Übersetzungen ins Deutsche, dass die verschiedenen deutschen Übertragungen dieses Schatztextes ihre eigentliche Funktion, Sterbenden während ihres Sterbens und in den Wochen danach vorgelesen zu werden, um ihnen so ein optimales Ableben zu ermöglichen, niemals erfüllen konnte, weshalb ein solches Vorgehen – das in buddhistischen Ländern vollkommen selbstverständlich ist – noch niemals in deutscher Sprache praktiziert werden konnte. Dies ist ausserordentlich bedauerlich, bedenkt man, wieviele Menschen – obwohl sie sich das sehnlichst wünschen – ohne den Beistand jener Tradition aus dem Leben scheiden müssen, die sicherlich über das tiefgründigste Wissen über die Vorgänge beim Sterben und danach sowie zudem über solche Methoden verfügt, die dazu beitragen, diese Vorgänge bis in ausserordentlich subtile Stufen des Sterbeprozesses hinein zu optimieren.
Leider krankt auch eine jüngst erschienene Neu-Übersetzung aus dem Amerikanischen zumindestens an ihrer anschliessenden Übersetzung ins Deutsche, bei der bedauerlicherweise ebenfalls die alten Fehler wiederholt worden sind. Zudem fügt der Übersetzer dem Text leider seine eigenen Erläuterungen und Ergänzungen an – ein Vorrecht, das traditionellerweise ausschliesslich den zugleich höchsten tibetischen Gelehrten und verwirklichten Meditationsmeistern vorbehalten ist (18). Deshalb kann auch diese Übersetzung nicht ihrem ursprünglichen Zweck, Menschen auf ihr eigenes Sterben und die Zeit danach vorzubereiten bzw. – wie der Titel schon sagt – anderen Sterbenden bzw. Verstorbenen bei diesem Vorgang zu assistieren, indem man ihnen diesen Text wiederholt wörtlich vorliest, gerecht werden. Kurz: Eine Neu-Übersetzung ins Deutsche war längst überfällig (19).
Читать дальше