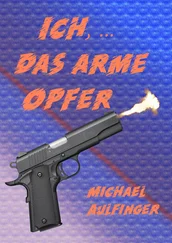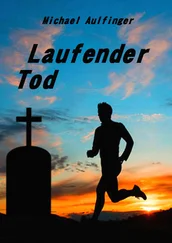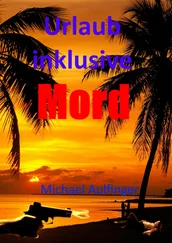„Das überrascht mich nicht. Ich habe schon lange mit ihnen gerechnet. Selbst im nicht so weit entfernten Bredenvelde haben sie sich schon vor Jahren niedergelassen und dort eines ihrer mächtigen Gotteshäuser erbaut. Von den Hufen im Süden habe ich am Rand der Felder schon das Haus der krastajanin erblicken können. Es hat einen spitzen hohen Turm. Jedenfalls wundert es mich nicht, dass sie jetzt auch hierher kommen.“
„Mich auch nicht.“ Die Stimme gehörte dem Starosta, dem Ältesten des Dorfes, und sein Name war Postwoi.
Der temperamentvolle Prabislaw hatte die Lösung für die Frage, die er selbst aussprach, auch gleich parat.
„Was machen wir jetzt? Sollen wir sie vertreiben? Ich bin dabei. Mit meinem Schwert werde ich sie wieder über den Limes zurück jagen.“
Mistiwoi ging zu seinem ältesten Sohn und legte ihm die Hände auf die Schulter. Ruhig sprach er zu Prabislaw.
„Wir werden keinen hier verjagen. Wir sind ein friedliebendes Volk und achten die Gesetze der Gastfreundschaft. Wir führen keinen Krieg mehr, sondern betreiben Ackerbau und Viehzucht. Wenn sie hier in der Nähe siedeln wollen, dann sollen sie es. Wir können alle hier zusammen leben. Es gibt für alle genug Äcker zu pflügen, und in den Wäldern ist genug Wild für alle. Hast du mich verstanden?“
„Aber …“
„Kein aber. Wir müssen in Frieden mit ihnen leben. Sonst kann es unser aller Untergang sein. Von welchem Stamm sind sie denn?“
„Das weiß ich nicht. Aber ich werde es herausfinden.“ Der fünfzehnjährige Prabislaw drehte sich sofort mit dem zwei Jahre jüngeren Taomir um und setzte mit dem familieneigenen Boot über die Delbende über, um an das andere Ufer zu gelangen. Bald war er aus den Augen der beiden Männer verschwunden, die einen Moment lang schwiegen und den Knaben nachdenklich nachgesehen hatten.
„Irgendwann musste es ja geschehen. Nördlich von hier, in Racisburg, und im Westen in Bredenvelde sind die Christen ja schon seit vielen Jahren. Aber bis hierhin hatten sie sich zum siedeln noch nie gewagt. Wir werden wohl mit ihnen leben müssen.“
Der Name Racisburg stammte vom Slawenfürsten Ratibor , kurz Ratse genannt, der die Feste vor über hundert Jahren gegründet hatte.
„Bleibt uns eine andere Wahl?“, fragte Mistiwoi.
„Entweder bleiben wir und versuchen mit ihnen auszukommen, oder wir ziehen weg. Nur wissen wir nicht ob wir dort, wo wir Land finden, ebenfalls willkommen sind, und ob dort ein guter Boden ist, der uns fortwährend ernähren kann. Was wir hier haben wissen wir jedoch. Oder sehe ich das falsch, Starosta ?“
Postwoi schüttelte den Kopf. Resigniert sah er auf die Mulne , an deren hinterem rechten Rand sich der Werder erhob. Auf der linken Seite des Werders konnte er von seinem Standort aus die höchste Erhebung erkennen. Dort sah er schon die ersten Christen ankommen und mit der Rodung beginnen. Es gab mal einen Thingplatz dort. Einst hatten sich auch wenige Hütten darauf befunden. Die Polaben nutzen den Werder jedoch nicht mehr.
Seit einigen Jahren hatte sich ein Frachtweg von Süden nach Norden gebildet. Die Händler hatten zusehends den Werder als Rastplatz auserkoren, weil er mittig auf der Strecke zwischen Lubecke und Louwenburg lag. Immer mehr Händler und Kaufleute kamen.
Mistiwoi und Postwoi hatten sich schon öfters über die bevorstehende Besiedelung durch die deutschen Völker in der slawischen Gegend unterhalten. Es war ein Prozess, der schon lange eingesetzt hatte, und überraschte sie eigentlich wenig. Weit im Norden an der Ostsee waren die Wagrier, ebenfalls ein slawisches Volk, ansässig gewesen. Doch dann hatten vor einigen Jahrzehnten Besiedelung und Christianisierung im Verbund begonnen. Unter herzoglicher, gräflicher und später auch bischöflicher Leitung wurden Siedler aus dem ganzen Reich angeworben.
Postwoi hatte als Ältester erfahren, wie im Norden die Polaben und Wagrier durch die von Westen einströmenden Siedler vertrieben oder assimiliert wurden. Einst hatte im Jahr 1143 Graf Adolf von Holstein vom Geschlecht der Schauenburger Boten nach Flandern, Holland, Utrecht, Westfalen und Friesland gesandt, um die Siedler anzulocken. Dies tat er mit den verlockendsten Versprechungen, ihnen die schönsten, geräumigsten, fruchtbarsten und an Fisch und Wild überreichsten Gebiete nebst günstigen Weidegründen und Äckern zu überlassen. Daraufhin brachen die Männer mit ihren Familien und ihrem gesamten Hab und Gut auf, um das versprochene Land in Besitz zu nehmen. Das es noch teilweise mit Slawen bevölkert war störte sie dabei nicht. Der Prozess der Verdrängung war nicht aufzuhalten.
Als dann das Bistum Racisburg 1154 in der neuen Grafschaft Racisburg gegründet wurde, dauerte es nicht lange, bis sich Bischof und Graf gemeinsam nach einer ständigen Einnahmequelle umsahen. Denn das Geld war auch hier knapp. So führten der Graf in den rein slawischen Dörfern der neuen Grafschaft, die gemischt Viehzucht und Ackerbau betrieben, den sogenannten Slawenzins ein, um an Geld zu gelangen. Doch nun ließ der Graf auch hier die Besiedelung durchführen.
Was sollten aber nun die Polaben tun? Die Slawen waren an sich ein fleißiges Volk, welches fest an althergebrachten Traditionen hing. Leidenschaftlich, und weil sie es seit Generationen stets so getan hatten, betrieben sie ihren Ackerbau und die Viehzucht.
In den Wäldern und auf den Wiesen gab es zu damaliger Zeit noch den Bären, Luchs, Elch, Ur, Wisent und den Hirsch. Das Wildgeflügel, welches reichlich vorkam, wurde mit Pfeil und Bogen, Speer, Schlinge, Fallgrube und der Falle gejagt.
In den vielen Seen rund um Mulne gab es viele Fischarten zu fangen. Handel wurde zwar auch, aber nur in geringem Maße betrieben. Vielweiberei war den Männern gestattet, doch dieses Recht wurde fast nur von den Vornehmen in den Sippen ausgeübt. Ihre Rechtsprechung bei Streitfällen war demokratisch. Die slawischen Völker kannten keine Stände, und auch keine erbliche Fürstenwürde. Für solche kleinen polabischen Dörfer wie am Mulne war die Sippengemeinschaft das wichtigste, und der Starosta war nur der Verwalter des Gesamtvermögens der Sippe. Aber wenn die Besiedelung so weiterging, würde von dem kleinen slawischem Dorf, am trüben Wasser gelegen, in naher Zukunft nicht mehr viel übrig bleiben.
Postwoi und Mistiwoi stand schweigend zwischen ihren Hütten und sahen zerknirscht auf die Mulne . All dies war in großer Gefahr. Sie wussten es nur zu genau.
Ihr Weg führte sie geradewegs nach Osten. Prabislav kannte den Weg, und Taomir folgte ihm wie gewohnt. Er hatte hier schon oft mit seinem Bruder, oder seinen wenigen Freunden, spielend verweilt. Hier konnte er seine Phantasien ausleben. Über die wildwachsenden Wiesen liefen sie zum Crusekenberg hinauf. Von dort hatten sie eine hervorragende Sicht auf den tief im Tal gelegenen Werder. Ihnen bot sich ein imposantes Bild.
Der gesamte Werder war eigentlich bis vor einigen Jahrzehnten unbewohnt gewesen. Nur im Süden hatte er einst Landzugang gehabt. Im Osten war ein an einigen Stellen verschieden breiter Graben gelegen. Dieser Graben war nicht tief, und demnach nicht allzu schwer zu durchschreiten. Prabislav hatte es schon früher beim Herumtollen oft probiert. Der Werder hatte eine Länge von einem Kilometer und eine Breite von 500 Metern. Auf dem Werder hatten sich bisher Sträucher, Bäume und Wiesen befunden.
Aber jetzt sollte sich das ihm gewohnte Bild drastisch ändern. Es hatte schon vor einigen Jahrzehnten begonnen. Seitdem waren die mit Salz beladenen Karren vom südlichen Luniburc her über die an der Elbe gelegene Stadt Louwenburg kommend auf den Werder gelangt. Die günstige Lage nutzten sie zur Pause, um nach Lubecke weiterzureisen. Im Laufe der letzten Jahre hatte sich Mulne als Rastplatz einen Namen gemacht. Die vorbeiziehenden Händler und Kaufleute hatten selbst dafür gesorgt, dass am nördlichsten Punkt des Werders eine zweiundsechzig Meter lange Holzbrücke gebaut worden war. Diese verkürzte und erleichterte die Reise enorm.
Читать дальше