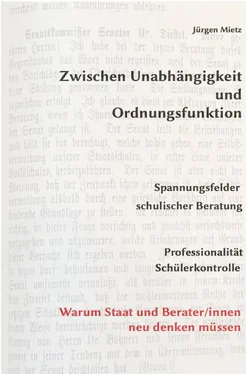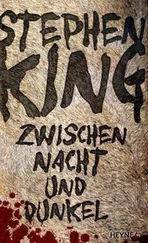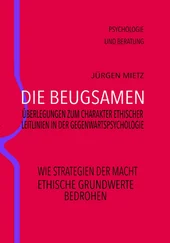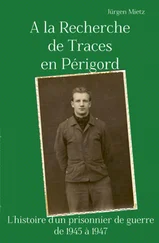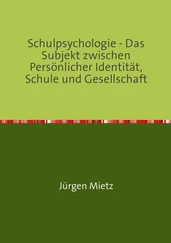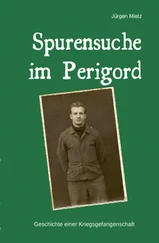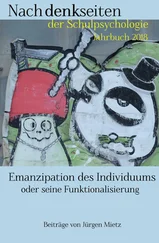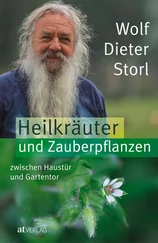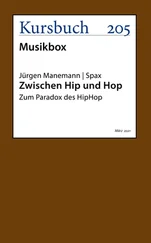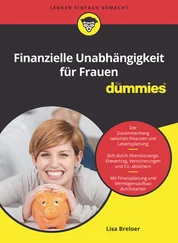Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 machten Schülerkontrolle und Schulfürsorge da weiter, wo sie aufgehört hatten: Kontrolle des Schulbesuchs und fürsorgerische Aufgaben waren dringlich. Sie verschoben sich im Laufe der Jahre hin zu pädagogischen Verständnissen[Fußnote 8].
Die Ausrichtung war sozial und pflegerisch, untrennbar damit verbunden war eine ordnungspolitische Funktion: Die Frage der Schulpflicht war immer wichtiger Inhalt der Schülerkontrolle und ihrer Nachfolgeorganisationen. 1948 wurde dann der Bezeichnung »Abteilung Schulpolizei«, die Teil der Schülerkontrolle war, abgeschafft.
Anfang der 1951 er Jahre stand aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine Zusammenlegung von Schülerkontrolle und Schulfürsorge an. Sie mündete in eine Organisation, die ab 1953 Schülerhilfe hieß. Die erfassenden, ermittelnden, zuführenden, tw. auch die strafenden Aufgaben blieben ihr erhalten.
Sicherstellung des Schulbesuchs, auch mit sogenannten »schulpflegerischen« Mitteln, war eine der Hauptaufgaben der neuen Organisation. Die allgemein miserable Lage der Nachkriegszeit bestimmte die Tätigkeit der Ermittler (so die gängige Bezeichnung). Die Hauptaufgabe bestand in der Eingliederung der Jugendlichen in ein einigermaßen geordnetes Leben.
Der Leiter der neuen Organisation Dr. Helmut Wiese plädierte für eine Stärkung von Beratung durch Lehrer, eine Ausrichtung, die von der Behörde unterstützt wurde. Jede Schule sollte einen Beratungslehrer haben. Sie wurden von der Schülerhilfe angeleitet und unterstützt; ebenso vom Lehrerfortbildungsinstitut. Das Konzept war, »die Lehrer sozialpädagogisch zu aktivieren« (Dr. Wiese). Man darf sich das vermutlich nicht als einen über einen längeren Zeitraum andauernden Prozess vorstellen, wenn man in Berichten die niedrige Zahl der Beschäftigen und die hohen Zahlen von Begutachtungen sieht.
So sehr Helmut Wiese auch für Beratung plädierte, so offen muss doch bleiben, welchen Charakter sie haben mochte. Das mögen einige Zahlen veranschaulichen. 1953 zählte er 543 schulpsychologische Untersuchungen, 1958 1171. 1958 befasste sich die Schülerhilfe mit 1255 straffällig gewordenen Schülern[Fußnote 9] . Zuständig waren zwei Psychologen (Lehrer).
Die Aufgaben der Schülerhilfe waren stark auf die Bedürfnisse der Schulaufsicht ausgerichtet, unter anderem in gutachtlicher Hinsicht. Zudem hatte sie beratende Aufgaben für Schüler und Lehrer. In den Vorschlägen zur Neuorganisation hatte Wiese selbst in Aussicht gestellt
»Die Schulfürsorge kann auch den Schulräten zeitraubende Untersuchungen abnehmen und durch gutachtliche Äußerung ihre Entscheidung vereinfachen.« (StA HH 361-2 VI 430-60)
Die Beratung war im Wesentlichen behördennah und erfolgt(e) aus schulinstitutionell-funktionaler Sicht; sie war eine Dienstleisterin. Der Vorschlag der Schulbehörde für die neue Organisation beinhaltete für Abteilung 1 (Schulpsychologische Beratungs- und Betreuungsstelle folgende Aufgaben:
• Klärung von Schulversagen
• Gutachten für die Schulbehörde
• vorübergehend Einzelunterricht Ausgeschulter
• Beratung unter Hinzuziehung der Schulärzte und Psychiatrischen Dienste
• Beratung der Lehrer in besonders schwierigen Fällen
Zur Abteilung 1 gehörten weiter die Schülerkontrolle und die berufspädagogische Dienststelle.
Die Schülerhilfe beteiligte sich ebenfalls bei schwierigen Fällen mit testpsychologischen Untersuchungen an der Schülerauswahl. In einer Konferenz wurden dem Oberschulrat ... die »Prüfungsunterlagen vorgelegt, und es wurden einzelne Fälle nochmals durchgesprochen«[Fußnote 10] .
Dieses Beratungskonzept steht in der Tradition, dass »gestandene Schulleute« auf dem Terrain der Schule, in Einklang mit den behördlichen Selbstverständnissen, agieren sollten. Man wollte »unnötigen Bürokratismus« vermeiden. Das war verbunden mit der Überzeugung, dass gestandene Schulleute einer Jugend in Not, in der Gefahr des »Absinkens«, mit einer Mischung aus Strenge und Milde den Weg weisen könnten[Fußnote 11]. Die Jahrzehnte praktizierte Aufgabe der Verfolgung von Schulversäumnissen, die »Ermittlungen« von Schulpflegern, das »Durchkämmen« von Wohngebieten bis mindestens in die 1960 er Jahre, die Bemühungen des Leiters Dr. Wiese um Personalaufstockungen dürften die Schülerhilfe kaum als Stelle mit freier, unabhängiger Beratung im Bewusstsein der Menschen innerhalb und außerhalb der Behörde verankert haben. Dass es beratende Hilfe für Lehrer und Schüler, sowie schul- und jugendpflegerische Aktivitäten gab, soll nicht bestritten werden. Ebenso wenig jedoch lässt sich übersehen, dass es Staat, Institutionen und Schulen waren, die die geltenden Muster vorgaben. Die Schülerhilfe war selbstverständlich in die steuernden Funktionen des Staates einbezogen.
Mit den Bemühungen um eine Erneuerung der Schule in den 1960 er und 70 er Jahre (Stichwort: Deutscher Bildungsrat, Bildungskommission, Bildungskatastrophe) konnten bundesweit neue Vorstellungen von Beratung, des Verhältnisses von Individuum/Bürger und Staat/Schule Raum gewinnen. Bis dahin hatte ein „besonderes Gewaltverhältnis” zwischen Staat und Schüler gegolten, wie es zwischen Staat und Gefängnisinsassen bestand. Demokratische und bürgerrechtliche Vorstellungen konnten Bestandteil von Schul- und Beratungsentwicklung werden. Diese „Lockerungsübungen“ konnten und sollten nicht die in den 1920 er Jahren verpasste Demokratisierung nachholen, sie verschafften jedoch Spielräume, in denen Neues geübt werden und sich professionelle Beratung gründen und mancherorts eine Tradition bilden konnte.
In mehreren Bundesländern kam es zu Neugründungen von schulpsychologischen Diensten und Schulberatungsstellen. Teilweise orientierte man sich am „bewährten” Hamburger Modell, teilweise nahm man Erfahrungswerte anderer Beratungsstellen (Erziehungsberatung, Therapie) auf. Mit einiger Ambivalenz gab es auch in Hamburg ähnliche Bewegungen einer Neuorientierung der Beratung und der Schulpsychologie. Diese „Unabhängigkeitsbestrebungen” stießen jedoch über die Jahre auf Misstrauen, wurden vermutlich als Subversivität eingestuft – vor dem Hintergrund der langjährigen Geschichte von Schülerkontrolle und Schülerhilfe erschiene das plausibel. Zudem dürften Widersprüchlichkeiten und Doppelbotschaften über die Aufgaben der Schülerhilfe bei Lehrkräften für Verwirrung und Enttäuschung gesorgt haben.
Mit der Gründung der ReBuS und später der ReBBz wurde den Bemühungen und Auseinandersetzungen um die Etablierung eines explizit subjektorientierten Ansatzes in Abgrenzung zum schulzweckorientierten Ansatz ein Ende gesetzt. »Gestandene Schulleute« wurden in der neuen Organisation den mehr an beratungsprofessionellen Grundsätzen orientierten Schulpsychologen an die Seite gestellt. Der schulsozialpflegerische und betreuerische Aspekt, dess Bedeutung nicht infrage gestellt sein soll, nahm an Bedeutung zu, die Schulpflichtfrage wurde wieder eine zentrale Aufgabe der Beratungsorganisation. Die Inanspruchnahme für behördliche Aufgaben mit Gutachten und Stellungnahmen (im Namen der Inklusion und für die Zuweisung von Schulbegleitungen) nimmt breiten Raum ein.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше