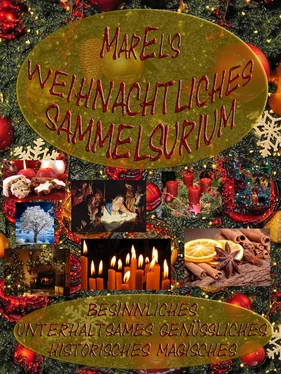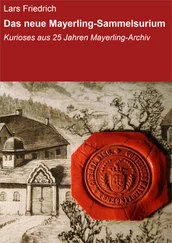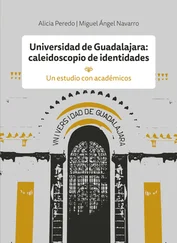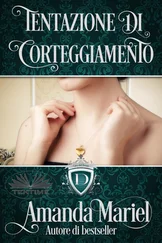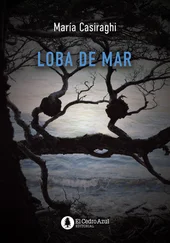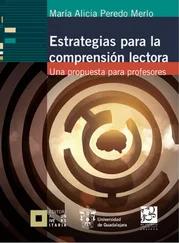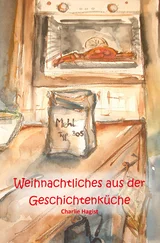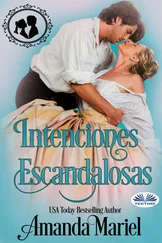Vorab sollte man erwähnen, dass man über die heilige Barbara nichts historisch gesichertes weiß. Alles stammt aus überlieferten Erzählungen und Legenden. Aber auch in Legenden sind oft Kerne von „Wahrheiten” enthalten, die es lohnt, zu finden und zu entschlüsseln. Wahrheiten, die über den Tag hinaus Gültigkeit besitzen und meistens ausgesprochen gut versteckt sind. Legenden sprechen normalerweise in Bildern und Symbolen. Wir sprechen heute direkt, mit Maßangaben und präzisen Zahlen und ohne verborgenen Sinn. Unsere oft oberflächliche Sprache hat wenig Tiefe, kennt oft nur eine leicht verderbliche Aktualität. Wie Pilatus scheuen wir vor der Wahrheit zurück und relativieren: „Was ist Wahrheit?” Unsere literarische Überlieferung, speziell die religiöse, hat aber Tiefen, Wahrheiten, die noch entdeckt werden können.
Die Barbara-Legende ist vermutlich vor dem 7. Jahrhundert im byzantinischen Raum entstanden. Über Byzanz gelangt sie um das Jahr 700 nach Italien. Als die Türken um das Jahr 1000 Kleinasien überrennen, erreichen die Reliquien das Kloster S. Giovanni Evangelista in Torcello. Sie sollen dort „in Sicherheit” verwahrt werden. Die Goldene Legende, die „Legenda aurea”, erwähnt im 13. und 14. Jahrhundert die heilige Barbara noch nicht. In liturgischen Heiligenkalendern ist sie aber schon nachweisbar. Wohl erst im 15. oder 16. Jahrhundert wurde die „Legenda aurea” um die heilige Barbara ergänzt. Das ist auch der Zeitpunkt, wo sie in der Volksfrömmigkeit den „heiligen” Daniel, den Propheten Daniel, ablöst, der bis dahin Patron der Bergleute war, weil er nach den Heiligen Schrift in der „Löwengrube” gesessen hatte (Dan 6,2-29). Seit dem 14. Jahrhundert wurden die Bergbaugebiete in Sachsen, Schlesien und Böhmen besondere Kultlandschaften der heiligen Barbara. Die Verehrung in den Alpen, mit Ausnahme in Tirol, stammt überwiegend aus der Gegenreformation des 17. und 18. Jahrhunderts. Im Ruhrgebiet fand die Barbaraverehrung Einzug mit den Bergarbeitern im neu eröffneten Bergbau.
Barbara, die schöne Tochter des Dioskuros, ein äußerst wohlhabender Kaufmann, wuchs in Konstantinopel (heute: Istanbul) während der Regierungszeit von Kaiser Maximinus Daia Anfang des 4. Jahrhunderts auf. Ihr wurde jeder Wunsch von den Augen abgelesen, weil ihr heidnischer Vater nicht wollte, dass sie zur Christin wurde oder sich zu einer Heirat verleiten ließ, die entgegen seines Glaubens war. So durfte sie auch in einem Turm eigene Gemächer bewohnen. Sie wurde von guten Lehrern unterrichtet. Einer dieser Lehrer, ein Freund des Schriftstellers Origines, erzählte ihr vom Christentum. Schließlich ließ sie sich heimlich taufen. Um einen heimlichen Treffpunkt für andere Christen zu haben, erbat sich Barbara von ihrem Vater die Einrichtung eines Badehauses, was er ihr sofort erfüllte. Barbara ließ zu den beiden Badezimmerfenstern ein drittes hinzufügen, als „Lob des dreifaltigen Gottes“.
Eines Tages hielt ein junger Mann um die Hand der schönen Barbara an und der Vater war nicht abgeneigt, sie ihm zu gewähren, weil der junge Mann von ähnlichen Stand und vermögend war. Sie wollte ihn aber nicht heiraten. Der Vater bedrängte sie nicht, sondern setzt auf Zeit und ging erst einmal auf eine lange Reise. Nach seiner Rückkehr eröffnete ihm Barbara, dass sie Christin ist und nicht daran denkt, einen Heiden zu heiraten. Der Vater reagierte unerbittlich und jähzornig stellte er sie vor die Wahl. Entweder sie heiratet die Heiden oder wird grausam bestraft. Daraufhin floh sie vor dem Vater, der sie mit gezücktem Schwert verfolgte, in einem Felsspalt, der sich wie ein Wunder für sie öffnete.
Ein Hirte beobachtete dies und verriet sie an den Vater, der sie dann auch fand, nach Hause schleppte und sehr schwer misshandelte. Aber das bestärkte sie noch in ihrem Glauben. Nachdem seine Untaten gegen die eigene Tochter nicht halfen, sie umzustimmen, brachte er sie zum römischen Statthalter Marcianus. Der sollte sie nach Reichsrecht wegen Hochverrat zum Tode verurteilen. Dieser ließ sie derart brutal durchprügeln, dass ihre Haut nur noch in Fetzen vom Körper runterhing und niemand mehr daran glaubte, dass sie die Nacht lebend übersteht.
Aber in der Nacht erschien ein Engel des Herrn, der alle Wunden heilte und ihr Beistand für die Qualen, die ihr noch bevorstanden, versprach. Der verbitterte Statthalter ließ sie in der Öffentlichkeit mit Keulen schlagen, die Brüste abschneiden und mit Fackeln foltern. Zu guter Letzt wurde sie zum Tode durch Enthauptung verurteilt. Vor ihrem Tod betete Barbara, daraufhin erschien wieder ein Engel und hüllte sie in ein schneeweiß leuchtendes Gewand. Letztendlich enthauptete der grausame Vater, der darum gebeten hatte, seine Tochter selbst. Er wurde kurz darauf auf dem Nachhauseweg vom Blitz getroffen und verbrannte, was sich alles der Legende nach im Jahr 306 am 4. Dezember unter Kaiser Maximinus Daia zutrug.
Wissenswertes rund um die Heilige Barbara
Schon in vorchristlicher Zeit war dieser Tag von besonderer Bedeutung. Sagen-Gestalten aus vielen verschiedenen europäischen Mythologien erscheinen in der Nacht zum 4. Dezember und erschrecken die Menschen. Diese werden von der Bevolkerung mit dem sogenannten "Bärbeletreiben" verjagt, damit das Glück, Schutz und Fruchtbarkeit einziehen kann.
Die heilige Barbara gilt als Patronin für Bergleute, Baumeister, Feuerwehrleute, Turmwächter und Glockengießer.
Wer die heilige Barbara anruft, wird nicht ohne Sterbesakramente sterben und hat somit die Garantie für den Eintritt in das himmlische Paradies. Da das Mittelalter und die vergangenen Jahrhunderte weniger nach dem verborgenen Sinn gefragt haben, war ihnen lediglich die Verheißung von Bedeutung.
Traditionell werden am 4. Dezember Barbara-Zweige von Obstbäumen, aber auch Flieder, Mandelbäumchen oder Forsythie, abgeschnitten und in Vasen aufgestellt. Zum Weihnachtsabend sollte der Zweig blühen und den Glanz verdeutlichen, den die Geburt des Erlösers gebracht hat. Außerdem sollen die Zweige mit seinen Blüten in der kalten und dunklen Winterszeit symbolisch Licht ins Haus bringen. Jedes Familienmitglied hat seinen eigenen Zweig, um daraus das Glück fürs kommende Jahr ableiten zu können.
Daneben gibt es den Barbara-Weizen. Am Barbaratag werden auf einem Teller Weizen- oder Gerstenkörner ausgesät, die bis Weihnachten aufsprießen sollen. Dieses „winterliche Grün“ ist als Teller-Saat oder Adonis-Gärtchen bekannt. Ist es bis Weihnachten voll zu einem dicken Büschel gewachsen, verspricht es reichen Erntesegen und ist zu Weihnachten ein Hinweis auf „das Licht der Welt“, nämlich Christus.
Außerdem finden in vielen Gegenden, besonders im süddeutschen Raum, Österreich und Schweiz Umzüge oder Aktionen unterschiedlichen Charakters zu Ehren der heiligen Barbara statt.
Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da.
Barbara im weißen Kleid, verkündet gute Sommerzeit.
Geht St. Barbara in Grün, kommt's Christkindel in Weiß.
Und wo hat die heilige Barbara als zweifache Lichtbringerin in der Vorweihnachtszeit ihren Platz?
Sie mahnt uns, auf dass wir uns immer des gegenwärtigen Todes bewusst sind und wachsam zu bleiben, sensibel für das eigene Versagen und einsichtig für die eigene Schuld. Sie leuchtet uns auf dem rechten Weg in den Himmel. In ihr spiegelt sich das Licht der Christusnähe. Eben dies drücken die Barbarazweige aus, in denen uns die Heilige gleichfalls zur Lichtbringerin wird. Was am Barbaratag als Zweig wie tot aussieht, wird in der Heiligen Nacht blühen und das Leben in seiner Fülle zeigen. In den Blüten leuchtet uns das Leben entgegen. In der längsten Nacht des Jahres wird der Sieg des Lichtes angekündigt.
Читать дальше