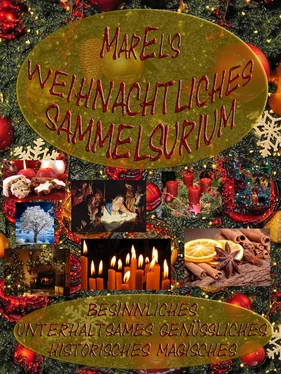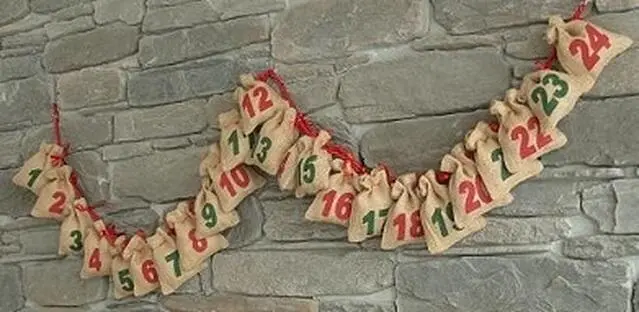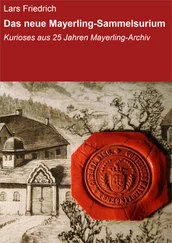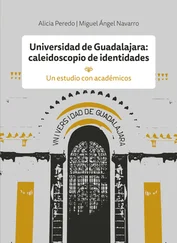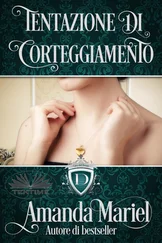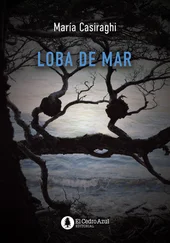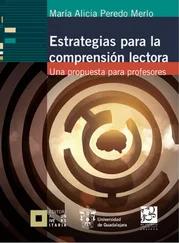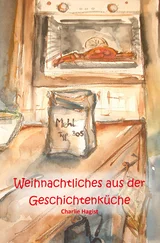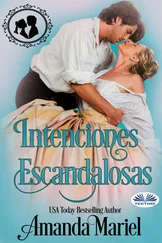Am 4. Adventssonntag lautet das Leitmotiv " Die nahende Freude" und ist Maria, der Mutter Jesu, gewidmet. Der letzte Sonntag vor der Ankunft des Gottessohnes steht für Verwirklichung, Ordnung, Manifestation, Ganzheit, Vollendung.
Wir treten in diesen Tagen in die stimmungsvolle Atmosphäre der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ein.
„Wir warten in Frieden, in der Zeit der Stille, finden zu uns selbst und sind bereit, das neue Licht (Jesus) zu empfangen.“
In der heutigen Konsumgesellschaft erleidet diese Zeit bedauerlicherweise eine Art kommerzieller "Verunreinigung", die ihren wahren Geist, der geprägt ist von geistiger Sammlung, Schlichtheit und einer nicht äußerlichen, sondern tief innerlichen Freude, zu verfälschen droht.
Es ist daher von der Vorsehung gewollt, dass - gleichsam wie ein Eingangstor zu Weihnachten - das Fest jener Frau gefeiert wird, die die Mutter Jesu ist und die uns besser als alle anderen dazu anleiten kann, den menschgewordenen Sohn Gottes zu kennen, zu lieben und anzubeten. Lassen wir uns also von ihr führen und von ihrer Liebe beseelen, damit wir uns mit ehrlichem Herzen und offenem Geist darauf einstellen, im Kind von Betlehem den Sohn Gottes zu erkennen, der auf die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen.


Die Tradition des Adventskranzes geht auf den lutherischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern (1808 - 1881) zurück, der obdachlose Kinder und Jugendliche in einem von ihm 1833 eingerichteten Hamburger Waisenhaus, dem "Rauhen Haus" , betreute und auch die Möglichkeit bot, einen Beruf zu erlernen. 1839 ließ Wichern im Betsaal ein altes Wagenrad mit 23 Kerzen aufhängen (19 kleine rote Kerzen für die Werktage und 4 große, weiße für die Sonntage). Beginnend vom 1. Advent wurde jeden Abend eine Kerze mehr entzündet. Irgendwann begann man, das hölzerne Rad mit Tannengrün zu umbinden.
Im Jahre 1860 führte Wichern den Adventskranz auch im Waisenhaus Berlin-Tegel ein. Seine Idee verbreitete sich langsam in Norddeutschland. 1925 hing der erste Adventkranz mit 4 Kerzen in einer katholischen Kirche in Köln, seit 1930 fortan auch in München. Um 1935 wurden auch die ersten häuslichen Adventkränze kirchlich geweiht, so wie es bis heute Brauch ist. Dieser Brauch verbreitete sich bis heute weltweit.
Die maximal 28 Kerzen wurden auf 4 reduziert. Es werden meist rote Kerzen verwendet, sinnbildlich für das Blut, was Jesus für die Menschheit vergoss - oder gemäß den liturgischen Farben der Adventszeit drei violette und eine rosa Kerze (für den Gaudete-Sonntag, dem 3. Sonntag im Advent).
Ursprünglich soll der Adventskranz die Zunahme des Lichts ausdrücken, so dass die Geburt Jesu Christi, der für die Christen das “Licht der Welt” bedeutet, zunehmend erwartet wird. Dazu kamen mit der Zeit Deutungen zur Kreisform, zum Tannengrün, zu den verschiedenen Farben der Kerzen und Schleifen. Er wird gern auf den Erdkreis und die 4 Himmelsrichtungen gedeutet. Zudem symbolisiert der Kreis die Auferstehung und somit das Licht der Ewigkeit, mit der Farbe grün wird auf das Leben hingewiesen und die Kerzen stellen das kommende Licht dar, das die Weihnachtsnacht erleuchtet.
Im katholischen Teil Irlands wird eine 5. Kerze in der Mitte des Adventskranzes der 4 Kerzen hinzugefügt. Sie wird an Heiligabend entzündet. Zudem gibt es Traditionen, in denen die Farben der Kerzen denen der Liturgie an den jeweiligen Sonntagen angepasst wird (violett, rot, rosa und weiß). In Schweden dagegen ist die erste Kerze weiß und die restlichen drei violett. Die weiße steht hier für die Paradiesfarbe.

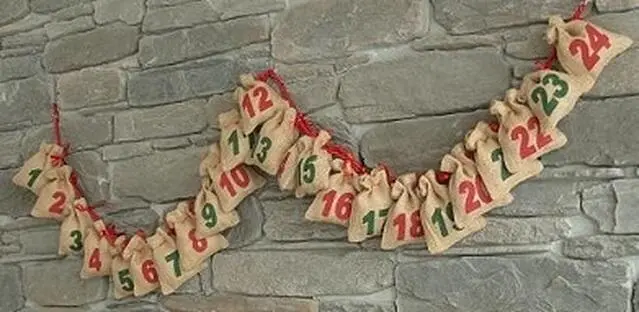
Die freudige Erwartung in der Adventszeit war schon immer gegenwärtig. Vor allem die Kinder zählen seit jeher ungeduldig die Tage bis zur Bescherung runter. Was war naheliegender, dass man etwas erfand, was nicht nur bildlich veranschaulichte, wie die Tage bis zum Fest immer weniger wurden, sondern zudem auch noch das Warten erleichterte.
Im protestantischen Umfeld fand man die ersten Adventskalender, die es im Laufe der Jahrhunderte in vielen Methoden und Formen gab.
Einige Beispiele:
Man hing jeden Tag ein religiöses Bild mehr auf.
Man malte 24 Kreidestriche an die Wand oder Tür, wovon jeden Tag ein Strich wegewischt wurde (Strichkalender).
Man legte 24 Strohhalme in eine Krippe, wovon jeden Tag ein Halm weggenommen wurde.
Dann gab es Weihnachtsuhren, die jeden Tag ein Stück weitergestellt wurden.
Oder man brannte eine mit 24 Markierungen verzierte Kerze jeden Tag ein Stück runter.
Der erste Adventkalender entstand im 15. Jahrhundert. Dieser Adventkalender zeigte ein Bild mit Maria, dem Kleinen Jesus und einem Baum. Die Zweige des Baumes trugen 24x den Buchstaben "A" für "Ave Maria".
Der erste selbstgebastelte Adventskalender ist vermutlich Mitte des 19. Jahrhundert entstanden.
Der erste gedruckte Adventskalender entstand Anfang des 20. Jahrhundert und bestand aus zwei Teilen. Ein Teil war ein bedruckter Karton mit 24 nummerierten Feldern, wo Verse aufgedruckt waren. Der zweite Teil war ein Blatt mit 24 Bildchen, wo man jeden Tag eins ausschneiden und auf den Karton mit den Versen kleben musste.
Der Adventskalender gewann schnell an Beliebtheit. Anfangs wurde er ausschließlich mit religiösen Bildern bedruckt, später wurden die Bilder eher weihnachtlich-weltlich. Im 2. Weltkrieg wurden Bildkalender, so auch der Adventskalender, aus Mangel an Papier verboten. Erst in der Nachkriegszeit wurden Adventskalender wieder hergestellt
Die Beliebtheit der Adventskalender ist bis heute ungebrochen. Es gibt unzählig viele Formen von Adventkalendern, mit Bildern, Schokolade oder andere Kleinigkeiten für Groß und Klein.

Die Idee zu diesem Gebet ist entstanden, als ich es in einer ähnlichen Form auf einer Social Media-Seite gelesen habe. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich von einen Gebet berührt. Ja, sogar zu Tränen gerührt, obwohl es nie in einer Kirche gesprochen wurde - oder vielleicht sogar genau deswegen? Es kommt einfach direkt aus den Herzen. Seit ich es kenne, lese und spreche ich es regelmäßig. Es gibt mir Kraft, Mut, Hoffnung und Trost.
Читать дальше