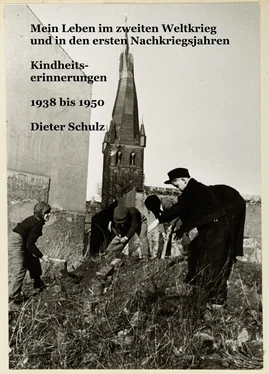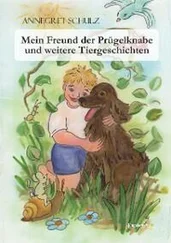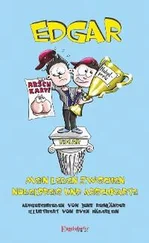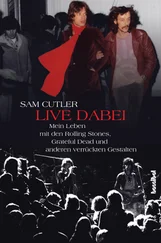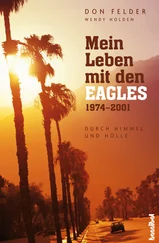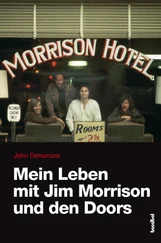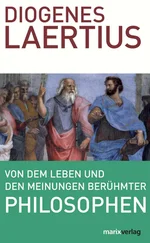Nun zu der zweiten Erinnerung, die mich mit dem Carl-Platz-Bunker verbindet: Nach dem Kriege, Anfang der 50er Jahre, wurde im nördlichen Teil des Bunkers auf der ersten Tiefgeschoss-Ebene ein Lichtspieltheater, also ein Kino, eröffnet. Der Eingang war ziemlich genau an der Stelle, wo meine Mutter und ich den KZ-Leuten bei der Zwangsarbeit zusahen. Das Kino, es hatte den schönen Namen „Kurbelkiste“, befand sich im vorderen Haupteingang des ersten Tiefgeschosses und war mit keinem anderen Kino vergleichbar. Es war ein Non-Stopp-Kino, das heißt, Eintritt war zu jeder Zeit. Die Eintrittskarten kosteten auf allen Plätzen 50 Pfennige, was etwa 25 EURO-Cent entspricht. In den meisten anderen Kinos kostete die billigste Eintrittskarte so um die 1 DM und darin lag der besondere Charme der Kurbelkiste, denn bei meinem monatlichem Taschengeld von 5,00 DM im ersten Lehrjahr als Technischer Zeichner konnte ich monatlich zehnmal ins Kino. Dafür nahmen meine Freunde und ich auch einige Nachteile in Kauf: Der erste Nachteil bestand in dem eher geringwertigen Angebot an Filmen. Es waren meist amerikanische Streifen aus den frühen 30er Jahren, die wohl in Amerika keiner mehr sehen wollte. Da wurden Filme wie „El Zorro“, „Dr. Fu-Man-Schu“, „Rauchender Colt“, „Lasst ihn baumeln“ und ähnliche cineastische Kostbarkeiten gezeigt. Den Ansprüchen von uns 15-jährigen wurde damit aber voll Genüge getan. Als Hauptnachteil musste aber die Bestuhlung angesehen werden. Während alle anderen Lichtspieltheater mindestens Klappsessel hatten, bestand die Bestuhlung der Kurbelkiste nur aus alten Gartenstühlen und nicht immer erwischte man einen solchen mit intakter Rückenlehne. Ein weiterer, auch nicht ganz unwesentlicher Nachteil, wurde aber angesichts der billigen Eintrittskarten ebenfalls vom Publikum toleriert. Das war der Toilettengeruch. Der umwehte diejenigen, die im Mittelparkett Platz genommen hatten. Dafür war die Belüftungsanlage verantwortlich, die im Krieg möglicherweise doch einen Treffer abgekriegt hatte. Ab meinem zweiten Lehrjahr verbesserte sich meine finanzielle Situation so deutlich, dass ich die Kurbelkiste links liegen lassen konnte, da ich mir nun den Besuch des EUROPA-Palastes leisten konnte. Meine Eltern hatten mir nämlich das monatliche Taschengeld auf immerhin 8,00 DM erhöht.
Nun aber zurück zu dem Bunkeraufenthalt: Während der ganzen Woche, die wir in dem Bunker verbrachten, gab es keinen einzigen Fliegeralarm für Düsseldorf. Hätten wir also in unserer Wohnung bleiben können? Theoretisch ja, aber praktisch musste man jeden Tag mit einem Luftangriff rechnen.
Der Luftschutzkeller unter der Friedenskirche
Wie gesagt, musste man jeden Tag mit einem Angriff rechnen und der kam dann auch wenige Tage, nachdem wir den Bunker verlassen hatten. Meine Mutter wusste aber ganz genau, wo wir uns in Sicherheit begeben würden. Das war der Keller unter der evangelischen Friedenskirche an der Flora-Straße. Dieser Keller war angeblich ganz sicher und es gab niemanden, der irgendwelche Bedenken gehabt hätte. Der Einwand einer Nachbarin, wonach nur die Evangelischen Zutritt zu diesem Luftschutzkeller hätten, erwies sich als Blödsinn. Auch Katholiken, wie wir, durften da rein. Ich erinnere mich, dass dieser Luftschutzkeller besonders groß war. Anerkennend zeigte mein Vater auf die vielen Betonstützen, die dem Keller eine große Stabilität gaben. In einer Ecke stand die Frischluftmaschine, ein großer, fassähnlicher Rundkörper, der auf einem Stahlgestell ruhte. Ein dickes Rohr führte von dem Rundkörper zur Wand. Der Frischluftstutzen war oben auf dem Rundkörper angeordnet. Links und rechts war je eine Kurbel, ähnlich wie bei einer Heißmangel. Ich hatte versucht, mittels einer der beiden Kurbeln die Frischluftversorgung in Gang zu setzen, was mir aber nicht gelang, da mir die Kraft dazu fehlte. Als die Luft aber besonders miefig wurde, betätigten zwei Luftschutzwarte den Frischluftfilter, indem sie kräftig kurbelten. Die Frischluft, die sie dabei in den Luftschutzkeller pumpten, roch stark säuerlich.
Diesmal galt der Angriff zwar Düsseldorf, aber wir in Bilk bekamen nicht allzu viel mit und nach dem lang gezogenen Heulton der Entwarnung verließen alle den Luftschutzkeller. Dabei waren Ausrufe der Erleichterung wie „Gott sei Dank“, „noch mal Schwein gehabt“ und so ähnliches zu hören. Auf dem Heimweg in stockdunkler Nacht wurden die Menschen auch ein Bisschen übermütig und es kam vor, dass jemand laut lachte. Das kam übrigens öfters vor, dass zwar wir in Düsseldorf-Bilk verschont blieben, dafür kam aber in anderen Stadtteilen einiges herunter und wenn die Erwachsenen davon sprachen, dass diesmal Rath, Gerresheim oder Derendorf getroffen wurden, kam es mir vor, als würde über andere Länder gesprochen.
Was geschah eigentlich mit den vielen Toten, die aus den Trümmern geborgen wurden? Wenn die nicht unmittelbar nach ihrer Bergung von Angehörigen identifiziert werden konnten, wurden sie zum Zwecke der Identifikation in den Kirchen der einzelnen Pfarreien aufgebahrt. Wer also einen Angehörigen vermisste, konnte in die für den Vermissten zuständige Kirche gehen und dort nachsehen. Für uns war das die Sankt-Peter-Kirche. Es muss grauenhaft gewesen sein, wie ich einmal einem Gespräch meiner Mutter mit einer Nachbarin entnehmen konnte. Danach waren die Toten kaum zu identifizieren. Manchmal konnten von den Toten nur einzelne Gliedmaßen geborgen werden. Manche Leichen hatten große, aufgeblähte Köpfe, was von dem Luftdruck der Luftminen kam. Von abgerissenen Köpfen und zerfetzten Gedärmen war auch die Rede. Furchtbar muss aber auch der Geruch gewesen sein, der von diesen körperlichen Überresten ausging.
Andere Kinder hatten von ihren Eltern ähnliche Schreckensnachrichten gehört und darum gingen wir zur Sankt-Peter-Kirche, um uns selbst ein Bild zu machen. Den Weg hätten wir uns aber sparen können, denn Kinder durften da nicht rein. Das war nämlich nichts für Kinder, auch nichts für die größeren von uns. Wir sollten alle schnell nach Hause gehen. Wir blieben aber vor der Kirche und beobachteten die Leute, die hinein gingen. Sie gingen irgendwie anders, als Menschen normalerweise gehen. Selbst uns Kindern fiel auf, dass sie das Allerschlimmste befürchteten. Zögernd und voller Angst betraten sie die Kirche. Wie aber verließen sie die Kirche? Die eine Frau, die da heraus kam, schnitt Grimassen, die uns normalerweise zum Lachen verleitet hätten. Niemand von uns lachte aber. Andere Frauen mussten von NSV-Helferinnen gestützt werden. Zum Weinen fehlte denen wohl die Kraft. Dann kam ein Mann aus der Kirche und dem fehlte nicht die Kraft zum Weinen. Er weinte und schüttelte sich dabei. Das ein Mann weinte, verwunderte uns sehr, denn das ein Mann weinen konnte, hätten wir nicht für möglich gehalten. Vielleicht war es nur ein Gerücht, aber es wurde erzählt, dass einige Menschen nach dem Besuch der Kirche nach Grafenberg, das heißt, in die Psychiatrie mussten. Das hässliche Wort von der „Klapsmühle“ war damals noch nicht gebräuchlich.
Verschickung nach Thüringen
Dann kam von der NSV, also von der National-Sozialistischen-Volksfürsorge, die Mitteilung, dass meine Mutter mit meinen beiden Brüdern und mir nach Thüringen verschickt würden. Wie unsere Mutter uns erklärte, war Thüringen ganz, ganz weit weg von Düsseldorf. Die Eisenbahnfahrt, auf der mein Vater uns begleitete, fand in der Nacht statt. Das empfand ich zwar als sehr schade, weil ich ja nichts von der Landschaft sehen konnte und besonders gerne hätte ich doch Berge gesehen, aber es musste sein, weil es wegen der Engländer zu gefährlich war, tagsüber zu reisen. Deren Flieger hätten nämlich unseren Zug beschießen können. Das jedenfalls hatte mein Vater mir so erklärt. Aber auch nachts waren die Züge nicht immer vor Fliegerangriffen sicher. Bei sternklarem Himmel und bei mondhellen Nächten waren die Züge von oben gut zu erkennen und boten den Fliegern ein deutliches Ziel. Dagegen hatten die Zugführer aber ein Mittel: Sie konnten den Zug einnebeln, der dann nicht mehr zu erkennen war. Also nachts war es am sichersten, zu reisen.
Читать дальше