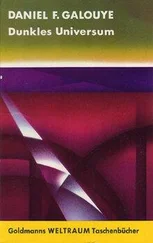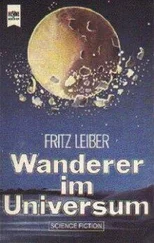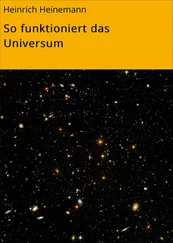„Ich gehe jetzt schlafen“, erklärte ich nach einer Weile des Schweigens und umarmte sie fest.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg, um die letzten Kilometer zur Innenstadtgrenze zurückzulegen. Gegen Mittag durchbrach Mike unser Schweigen, indem er auf einem Stück Asphalt stehenblieb und die Hand hob.
„Wie ihr seht, sind wir da. Am besten gehen wir da jetzt selbstsicher rein und suchen uns einen Unterschlupf. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, guckt euch den Himmel an. Haltet Ausschau nach U-Bahn-Eingängen, intakten Räumen und Höhlen unter Trümmerstücken. Tja, die Gangs werden tun, was sie für richtig halten. Lasst mich reden und hofft das Beste, falls sie uns aufhalten sollten.“
„Alle für einen, einer für alle!“, riefen wir halbherzig im Chor. Unser Motto. Stärkt den Zusammenhalt, sagt mein Vater.
Dann liefen wir weiter. Am Himmel begannen sich dunkle Wolken aufzutürmen. Auch das noch … Seite an Seite drangen wir in den Randbezirk des zerstörten Stadtkerns ein. Alles war grau, selbst das Unkraut, das langsam die Oberhand über die Steine gewann. Wege gab es so gut wie keine, ab und zu kreuzten wir leicht ausgetretene Trampelpfade. Die Trümmerhaufen und Schrottberge überwanden wir kletternd, während wir manchmal auch durch halbe Tunnel unter den Bruchstücken gehen mussten, die nicht unbedingt vertrauenerweckend aussahen. Dann sah ich rechts das erste Lager zwischen aufragenden Betontrümmern. Drei ausgemergelte Personen mit ausdruckslosem Blick starrten zu uns herüber. Aber irgendwie schienen sie durch uns durchzusehen. Mir war mulmig zumute, schnell blickte ich weg. Ein dicker Knoten saß in meinem Hals. Waren sie überhaupt noch lebendig? War irgendjemand außer uns noch lebendig? Ich biss die Zähne zusammen und folgte dem Clan.
Niemand sprach ein Wort. Ich fühlte mich wie eine Gefangene der toten Stadt. Die Stille lastete auf uns, kein Lüftchen regte sich. Mein Cousin schlief auf seiner Trage, wir anderen waren von dem langen Fußmarsch am Ende. Ein Wunder, dass wir es überhaupt bis hierher geschafft hatten. Anscheinend waren wir gerade noch rechtzeitig gekommen, wenn man sich den Himmel ansah. Abermals überwanden wir einen hohen Trümmerbrocken. Niemand hielt uns auf. Plötzlich zuckte ein Flashback durch meinen Kopf.
Ich renne immer weiter. Vor mir taucht eine Trümmerwand auf. Der perfekte Moment. Als ich sie erreiche, beginne ich zu klettern. Es ist schwer, aber ich kann es schaffen. Tränen rollen heiß über mein Gesicht.
Ich stolperte und war wieder in der Wirklichkeit. Diese Szene bestätigte nur, dass ich nie nach Berlin hätte zurückkommen dürfen. Wieso hatte mein Vater das zugelassen? Er kannte doch die ganze Geschichte. Irgendwann würde ich vollkommen durchdrehen. Gewaltsam verbannte ich die scheußliche Erinnerung aus meinem Kopf und ging weiter.
Auf einmal durchrollte ein grollendes Geräusch die trostlose Trümmerebene. „So ein Mist, es gibt wirklich einen Sturm“, rief Mike durch den zunehmenden Wind.
Die Gefahr drängte meinen Panikanfall in den Hintergrund, ich war voll da. Ich hasste es, wenn einen diese bescheuerten Stürme so überraschten. Seit dem schwarzen Jahr zogen im Winter große Tiefdruckgebiete über Europa, die schlimme Stürme verursachten. Die tödliche Gefahr dieser Orkane waren unkalkulierbare Böen, die mit unvorstellbarer Kraft über das Land fegten und alles durch die Luft fliegen ließen, was nicht niet- und nagelfest war. Wenn wir jetzt nicht sofort einen Unterschlupf fanden …
Der Clan erhöhte mit letzter Kraft das Tempo, mein Vater an der Spitze. Angelo hatte zusammen mit Alex´ Vater Lucas Trage übernommen. Ein paar Minuten später zuckten die ersten Blitze über den Himmel. Um uns herum befand sich nur Schutt, kein auch noch so kleiner Unterschlupf war in Sicht. Der Wind wurde immer stärker und trieb mir Staub in die Augen. Auch die Temperatur fiel steil ab.
„Noch fünf Minuten“, schrie Mike zwischen zwei Böen. „Dann müssen wir uns irgendwie verschanzen, sonst wird es übel!“
Verbissen stemmte ich mich gegen den Wind und hielt die Augen, soweit es vor Staub ging, offen. Es blitzte und donnerte nun im Sekundentakt. „Sind noch alle da?“, brüllte Mia. Wenn jetzt jemand verloren gegangen war …
„Da, zu dem Graben!“, brüllte Mike. „… unsere einzige Chance!“, verstand ich nur. Als wir uns zusammendrängten, konnten wir durchzählen: Alle da. Bis auf eine. Das Herz rutschte mir fast die Hose.
„Maja!“ Ich schrie mir fast die Lunge aus dem Hals, aber sie kam nicht. Das konnte, durfte nicht sein.
Plötzlich packte meine Großmutter mich am Arm, ich fuhr zusammen. „Ruhe. Hör doch mal genau hin!“ Die Donner legten passenderweise eine kurze Pause ein, und ich hörte einen Hund irgendwo in der Nähe bellen. Doch Maja kam nicht.
„Sie ist bestimmt irgendwo eingeklemmt und braucht Hilfe!“, schrie ich Mia ins Ohr und riss mich los.
„Bleib hier, es ist zu gefährlich!“, rief sie mir hinterher, doch ich kümmerte mich nicht darum. Maja war meine treueste Begleiterin. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Langsam kämpfte ich mich voran, dem nicht endenden Gekläff entgegen. Zusätzlich fing es auch noch an, zu regnen. Aber kein Wasser. Es regnete Asche.
Hoffentlich wurde das jetzt nicht der Weltuntergang. Ich musste die Hündin unbedingt sofort finden. Halb kriechend umrundete ich ein senkrecht stehendes Asphaltstück. Dann sah ich sie, keinesfalls hilflos! Mit wehenden Ohren und aufgestelltem Schwanz stand sie vor einer Lücke zwischen zwei Trümmern und kläffte sie wie wild an. Als Maja mich bemerkte, kam sie zu mir, lief dann aber zu dem Loch zurück. Ihr aufgeregtes Verhalten musste doch einen Grund haben, vielleicht hatte sie etwas Wichtiges entdeckt. Endlich stand ich vor dem Spalt. Er war so groß, dass ein Mensch gerade hindurchpasste. Während ich ihn noch abschätzend ansah, verschwand Maja im Dunkeln. Ich pfiff zwischen den Zähnen, glücklicherweise war sie kurz darauf wieder da und stand hechelnd in dem Eingang. Einem Eingang zur U-Bahn!
Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und ich konnte nun Stufen erkennen, die unter die Erde führten. „Schlauer Hund!“, sagte ich. „Komm, wir müssen die Anderen holen!“ Doch sie machte keine Anstalten sich zu bewegen und legte sich in den Staub. Egal, ich hatte keine Zeit für ihre Launen. Also stemmte ich mich erneut gegen den tobenden Wind. Dicke Regentropfen mischten sich unter die Ascheflocken. Ein schwarzer Brei sammelte sich auf dem Boden. Als ich meinen Blick zum Horizont wandte, wusste ich, warum Maja darauf bestanden hatte, in ihrem Unterschlupf zu bleiben. Eine graue Wand rollte wie ein Sandsturm auf uns zu, sog alles in sich hinein, was der Wind vom Boden lösen konnte. Das war gar nicht gut, uns blieb nicht mehr viel Zeit! Ohne jede Vorsicht rannte ich los, es kam auf Sekunden an.
Der Rest der Gruppe erwartete mich schon angespannt, ihnen schien die aktuell drohende Gefahr über mein Verschwinden noch nicht aufgefallen zu sein. Über ihren Köpfen hatten sie eine Zeltplane ausgebreitet, aber das würde kaum irgendetwas bringen. Mike begann zu sprechen, aber ich unterbrach ihn, richtete meinen Finger auf die sich bedrohlich aufbauende Sturmwand und schrie: „U-Bahn! Kommt!“ Zum Glück handelten sie sofort, statt das brodelnde Ungetüm nur anzustarren. Wir rafften alle Sachen zusammen und arbeiteten uns im Höchsttempo zu Maja vor.
Das Zentrum des Orkans kam schnell näher, es war beinahe unmöglich, sich auf den Beinen zu halten. Mit verkrampften Fingern umklammerte ich meine Habseligkeiten, dann kam der Spalt in Sicht. Noch einmal trotzten wir dem Wind und taumelten mit letzter Kraft in die Dunkelheit. Wir tasteten uns immer tiefer, bis man den heulenden Wind nur noch dumpf in der Ferne hören konnte. Irgendwann erreichten wir das Ende der Treppe und setzten uns erst einmal hin. Es war stockduster, man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Ab und zu hörte man einen Seufzer und ich realisierte, dass ein Hund uns gerade das Leben gerettet hatte.
Читать дальше