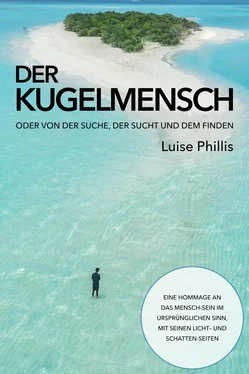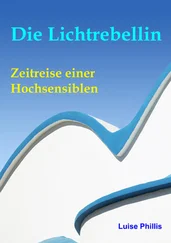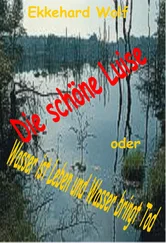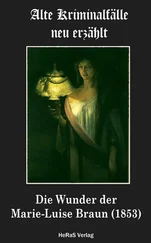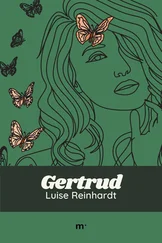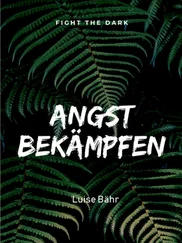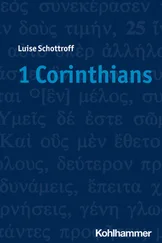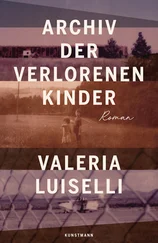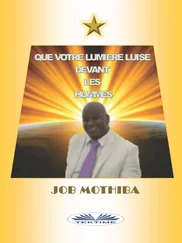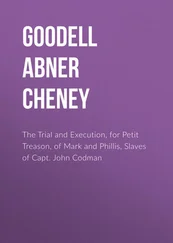„ Es stellte sich heraus, dass es mir nicht nur miserabel ging, sondern dass es mir schon immer miserabel gegangen war, und dass ich alle Voraussetzungen dafür erfüllte, dass es mir auch in Zukunft miserabel gehen würde.“ (ebd.)
Er war das erste Mal in seinem Leben wirklich zornig und somit ursprünglich authentisch. Mit diesem Gefühl des Zorns schrieb er dieses Buch, und lernte im Angesicht des Todes ebenfalls das erste Mal in seinem Leben für sich selbst einzustehen, er begann das erste Mal für sich zu kämpfen. Er wütete gegen den Tod, nannte seine Krankheit „Mars“ und verstand sie als Krieg und so endet sein Roman mit dem Satz: „Ich erkläre mich als im Zustand des totalen Krieges. “ (ebd.)
Er rechnete mit seinen Eltern ab, die für ihn bei dieser Abrechnung nicht als Individuen schuldig und relevant waren, dafür aber stellvertretend für die bürgerliche Gesellschaft schuldig gesprochen wurden, da sie für ihn die konservativen Erziehungsmethoden und -strukturen der damaligen Gesellschaft (40er – und 50er Jahre des 20. Jahrhunderts) repräsentierten: Er verlor diesen Kampf, denn er starb mit 32 Jahren. Er hatte aber dieses Buch als Manuskript fertiggestellt und erfuhr einen Tag vor seinem Tod, dass es einen Verleger dafür gäbe.
Das Erschütternde und Berührende ist die Tatsache, dass es sich hier nicht um eine Romanfigur handelt, sondern um eine Autobiografie.
Mit diesem Buch hat Fritz Zorn, der ja eigentlich Angst hieß, seiner Nachwelt ein wichtiges Dokument geschaffen, das die ungeheuren Konsequenzen aufzeigt, die ein Leben mit unbewältigter Angst mit sich bringt, nämlich den zu frühen und abrupten Tod.
Fritz Zorn hatte sich nicht wie der „Unfreiwillige Wanderer“ auf den Weg machen können, denn bei ihm waren die Intuition, die innere weise Stimme der Alten und der Instinkt, den der Wanderer als Narr schließlich entdeckt, verschüttet, durch eine zu starre, konventionelle Erziehung. Er hatte nicht die Möglichkeit, sich von den Eltern innerlich wirklich zu lösen. Er lebte nicht nach seinem eigenen Lebensentwurf, sondern unbewusst ausschließlich nach den Normen der elterlichen Erziehung Also funktionierte er nur nach außen und verspürte nicht einmal die Sehnsucht nach seiner Urheimat. Er lebte also unbewusst in dem folgenden Sinne:
Wer sich nicht auf die ureigene Suche macht, hinterlässt keine Spuren.
Deshalb fühlte er sich so depressiv und allein, aber auch wieder nicht allein genug, denn dann hätte er ja wiederum die wirkliche Nähe der Menschen gesucht. Er fand so natürlich auch nicht die Nähe zu sich selbst. Erst bei seiner Krankheit, die ihn mit dem Tod konfrontierte, empfand er so etwas wie Authentizität, für die es sich dann wieder gelohnt hätte weiter zu leben, was Fritz Zorn aber nicht mehr gelungen ist. Dafür hat er allerdings dieses Dokument geschaffen, das seiner Nachwelt der Mahnung dient, es anders zu machen, sich aufzumachen zur Urheimat.
Das Lebensfeindliche seiner Biografie ist die Angst (in diesem Falle nicht nur ein Spruch: sondern „nomen est omen“), sich auf sich selbst einzulassen, offen gegen die Eltern zu rebellieren, zu riskieren, dass er in eine echte tiefe Traurigkeit fällt wie der „Unfreiwillige Wanderer“, dass er sich traut er selbst zu sein.
Es gibt Elternhäuser, in denen es den Kindern schwer gemacht wird, sich zu lösen, um das Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Es sind oft die Elternhäuser, die eine äußerliche Bequemlichkeit bieten, die eine Angstvermeidungsmöglichkeit provoziert. Die Existenzphilosophie von Karl Jaspers (1883-1969, vgl. : „Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen“. Bremen 2. Aufl. 1947) und Martin Heidegger (1889-1976, vgl. „ Sein und Zeit“, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2002) sowie der Existentialist Jean-Paul Sartre (1905-1980, vgl. „Das Sein und das Nichts“, Akademie Verlag, 2003) haben ihren Werken die Angst als zum eigentlichen Dasein des Menschen zugehörig beschrieben. Es gilt sie wahrzunehmen, sie anzunehmen, um sie dann wieder loslassen zu können. Es bedeutet, die Lebenssituationen, die uns vereinzeln, die uns auffordern uns von den Anderen, vom „Man“ (so Heidegger) abzuheben, um unseren individuellen ureigenen Weg zu gehen. Das bedeutet zunächst Angst vor der Einsamkeit, und sogar die Angst vor dem „Nichts“, wir lassen uns auf das ein, was wir nicht kennen, so wie der Narr, der junge Wanderer vor dem Abgrund. Doch er kann sein Leben „anpacken“, nachdem er allein durch den dunklen Wald gegangen ist und in seinen eigenen Abgrund geblickt hat. So kann er mit Leichtigkeit seinem Lebensabenteuer begegnen, denn die erste große Hürde hat er genommen, er ist durch die Todesangst durchgegangen und auf diese Weise auf seinen eigenen Lebensweg gelangt.
Es ist also wichtig, den „tiefsten Punkt“, die schattigste Seite in seinem Leben anzunehmen, um sich auf geistiger Ebene weiter entwickeln zu können.
Hierzu möchte ich ein Beispiel aus meiner philosophischen Lebenspraxis zeigen, das die Notwendigkeit sich im Leben auf die eigene Suche zu begeben beweist
.
Ein Beispiel für eine gelungene Abnabelung vom Elternhaus aus der philosophischen Lebensbearatungspraxis
Martin S., Jahrgang 1950, hatte eine komplizierte Kindheit. Seine Eltern hatten keine Zeit für ihn und seinen 3 Jahre ältern Bruder. Allerdings hatte er eine Kinderfrau, die liebevoll mit ihm umging und zu der er auch eine emotionale Bindung hatte. Jedoch war die Mutter eifersüchtig auf diese positiven Gefühle Martins gegenüber der Kinderfrau, so dass sie ihm verbot, abends, wenn sie zu Hause war, mit der Kinderfrau zu sprechen und diese auch nur irgendwie sprachlich zu erwähnen. Das quälte ihn natürlich sehr als Kind, und er fühlte sich innerlich zerrissen, was seine aufrichtigen Gefühle betraf, zum einen die für seine Mutter und zum anderen die für seine Kinderfrau. Der Vater war nur am Wochenende da und wollte dann auch nur immer eine harmonische Stimmung. Martin fühlte sich nie wirklich wohl in seinem Elternhaus. Er genoss allerdings eine hervorragende Bildung an einer Privatschule. Er ging sehr früh aus dem Haus, er machte sich auf seinen eigenen Lebensweg und entschied sich dafür, sich ins Leben zu stürzen. Bereits damals, er war 16 Jahre alt, hatte er sich zu einem Teil von seinem Elternhaus abgenabelt. Nur so entging er einer Depression und einer Neurose. Er übernahm früh Verantwortung für sich und schaffte es eines Tages dank einer philosophisch-psychologischen Lebensberatung seinen Eltern wahrhaft zu verzeihen und in aller Ganzheit zu verstehen, dass sie so gehandelt haben, wie sie es damals konnten, besser wussten sie es nicht. Martin ist heute ein erfolgreicher Künstler und hat viele Abenteuer auf seiner Suche erlebt und durchlitten und ist immer gestärkt und ein weinig weiser aus ihnen hervorgegangen.
Unsere gemeinsame Suche nach unserer Urheimat geht im folgenden Kapitel weiter mit einem weiteren Märchen.
2. Kapitel Verausgaben des eigenen Potenzials oder vorläufig aufgehoben beim fahrenden Volk
Der Magier beim fahrenden Volk
Wer sich auf die Suche macht, hinterlässt Spuren
Verausgaben des eigenen Potentials oder vorläufig aufgehoben beim fahrenden Volk. Das Fehlen der weiblichen Intuition oder die Notwendigkeit sich auf die männlichen Seelenkräfte zu besinnen
Wir haben im vorhergehenden Kapitel gesehen, wie wichtig es ist, sich auf die Suche zu machen. Wenn wir das Versäumen, dann haben wir tatsächlich unser Leben verwirkt und wir können sehr depressiv und krank werden.
Sind wir aber aktiv auf unserer Suche, so sind wir auf unserem Weg, der uns die Richtung zeigt, wenn wir es wollen. Die Begegnung mit dem Leben, mit unterschiedlichen Menschen, Situationen und Lebensbereichen bringt die menschliche Seele in Kontakt mit den unterschiedlichen Aspekten der tieferen Seinsschichten. Dabei ist es wichtig, dass wir zunächst die männliche Energie, das Yang in uns entdecken. Wir benötigen beide Aspekte, das Yin, das weibliche, das Annehmende, das Verbindende, den Mond, die Nacht, das Intuitive genauso wie das männliche Lebensprinzip, das Gebende, das Punktuelle, die Sonne, den Tag, das analysierend Verstandesmäßige. Sind beide Aspekte im Einklang und gleich berücksichtigt, so ist das Leben leicht und erscheint fast vollständig. Leider werden diese beiden Lebensprinzipien oft ungleich ausgelebt und befinden sich deshalb im Widerstreit. Dies wird auf der seelisch-geistigen Ebene als unharmonisch, Unausgeglichenheit, Unzufriedenheit und Unvollständigkeit und deshalb auch als Sehnsucht erlebt. Wenn wir diese beiden Lebenskräfte, das Weibliche und das Männliche als die zwei Urprinzipien des Lebens erkennen und diese tief in unsere Seele integrieren, dann wird uns auch eine Lebendigkeit zu Teil, die das Leben lebenswert macht, mit allen Höhen und Tiefen. Wir erfahren das Leben mit der Lebensmagie, dem Zauber, der Freude, aber auch mit Traurigkeit, Freude und Leiden. Diese beiden Lebensprinzipien bedürfen der Entdeckung und Beachtung in der eigenen Seele und entsprechen und spiegeln uns unsere eigenen Seelenkräfte die Menschen wider, denen wir im Außen begegnen. Wichtig ist allerdings zu beachten, dass wir auf unserer aktiven Suche nach unserer Urheimat zunächst die männliche Energie erkennen und gegebenenfalls erwecken und stärken müssen. Denn sie ist es, die das handelnde Moment in uns ermöglicht. Sie lässt uns agieren und uns auf das Leben zugehen. Dabei müssen wir lernen mit dieser Kraft sorgsam umzugehen, sie nicht zu vergeuden. Die weibliche Seelenkraft wird sich während der Lebensreise in ihrer Stärke entwickeln, ist im folgenden Märchen allerdings erst ansatzweise ausgeprägt. Wir sind ja auch erst ganz am Anfang unserer Reise.
Читать дальше