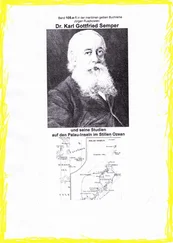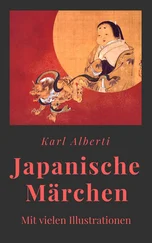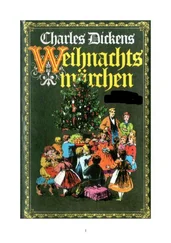Karl Knortz
Amerikanische Märchen auf 449 Seiten
Märchen und Sagen der Indianer Nordamerikas
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Karl Knortz Amerikanische Märchen auf 449 Seiten Märchen und Sagen der Indianer Nordamerikas Dieses ebook wurde erstellt bei
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Impressum neobooks
Märchen und Sagen der Indianer Nordamerikas
Einleitung
Ich weiß nicht, ob es gerade ein lohnendes Unternehmen
ist, die Märchen, Sagen und Fabeln der wilden
Rothäute der nordamerikanischen Urwälder und Prärien
zusammenzustellen; äußerst mühevoll ist es sicher,
das so weitläufig zerstreute Material aus den vielen
englischen und französischen Büchern und mündlichen
Berichten der Missionare, Dolmetscher, Reisenden
und Indianeragenten zu kollektieren, zu ordnen
und umzuschreiben. Doch glaube ich, daß es jedenfalls
eine interessante Aufgabe ist, der ich mich hier
unterzogen habe, denn statt der Anzahl der bisherigen
stereotypen Skalpgeschichten hält uns eine solche
Sammlung einen klaren Spiegel indianischen Gemütslebens
vor, bestehend in uroriginellen, wild aufgeschossenen,
zwischen Blumen, Gras und Wigwamstangen
gekeimten Phantasien, mit denen sich der alte
Medizinmann schon mehr als tausendundeinmal ein
»heiligeres« Ansehen gegeben und der vom rauhen
Kabibonokko in den Wigwam gebannte Familienvater
seinen Kindern schon ebensooft Hunger wie Langeweile
vertrieben hat.
Nur im Winter hat der Indianer zu solcher Unterhaltung
Zeit und Muße, denn im Sommer, wenn »die
Wildnis blüht wie eine Rose« und ihn die Strahlen
der Sonne aus der engen Hütte jagen, verbieten ihm
sein Gewissen und seine Sicherheit jene Phantastereien,
denn es würden ihm dann zur Strafe, wie die alten
Propheten lehren, Kröten und Klapperschlangen die
nächtliche Ruhe rauben.
Ruhig sitzt er dann neben seinem glimmenden
Baumstamm, raucht gelassen seine Pfeife und läßt
sich dabei, wenn er gerade sprechselig und nicht allzu
hungrig ist, ob seiner merkwürdig verschlungenen
Geschichten bewundern, wie er sie fand:
In des Waldes Vogelnestern,
In dem Hüttenbau des Bibers,
In des Büffelochsen Hufspur,
In dem Felsenhorst des Adlers.
Da erzählt er seine haarsträubenden Sagen von himmelhohen
Riesen, deren Mäntel aus Skalpen und
deren Trinkgeschirre aus Schädeln ihrer Feinde bestanden;
von Mammutbüffeln, die so große Füße hatten,
daß sie mit einem allein den größten Wald niedertreten
konnten; von baumstarken Manitus, deren
Anzahl sich wie die Götter der Hindus nur nach Millionen
berechnen läßt, oder von leichtfüßigen Elfen,
die wie die Virgilsche Camilla über die Flüsse liefen,
ohne sich die Füße zu benetzen, oder über einen Kornacker,
ohne eine Ähre zu knicken – und das Echo
dieser Erzählungen tönt doch sicherlich viel angeneh-
mer und lieblicher als das jener vielen absichtlich entstellten,
von müßigen Köpfen dem Geschmack des
ungebildeten Publikums angepaßten Greuelgeschichten,
die sich von zahlreichen »zivilisierten« Völkern
in noch bedeutend grelleren Farben aufzeichnen ließen,
wenn den Lesern nur damit gedient wäre. Aber
die arme Rothaut ist einmal vor der öffentlichen Meinung
in Ungnade gefallen, und sie ist bereits auch zu
alt und zu schwach geworden, um vielleicht noch die
Zeit eines günstigen Umschwungs erleben zu können,
und es wird auch nicht mehr lange dauern, daß ihre
Geschichte, die ja bis jetzt nur von ihrem Untergang
handelte, wie ein aus uralten Zeiten überliefertes Märchen
klingen wird; denn die Beherrscherin der Welt,
die Zivilisation, hat jene traurigen Gestalten längst für
überflüssig erklärt und ihnen schon seit geraumer Zeit
im Urwald die dickste Eiche umgebogen, die ihnen
den Weg zum nahen Grab zeigt.
»Das Geschlecht der Kornsäer ist mächtiger als das
der Fleischfresser.«
Die Zivilisation ist eben mit einem wohlgepflegten
Garten zu vergleichen, dessen Hüter hauptsächlich
darauf angewiesen ist, die wilden Tiere davon fernzuhalten.
So ist's mit dem Indianer. Als sich herausstellte,
daß ihm das Wort »Fortschritt« ein unbekannter Begriff
war, der weder in seinem Kopf noch in sein gan-
zes Leben paßte, sahen sich die Blaßgesichter gezwungen,
ihm seinen besonderen Boden anzuweisen,
wo er mit seinem Freund, dem Büffel, in gleicher Kategorie
stand und nur noch insofern als höheres Geschöpf
betrachtet wurde, als er ständig das willfährige
Werkzeug zu den nichtswürdigsten Spekulationen
abgab.
Zwar wurden für ihn die mildesten und humansten
Gesetze und Bestimmungen erlassen, und sein Land
wurde ihm so teuer bezahlt, wie man es einem Weißen
hätte bezahlen müssen, aber er erhielt doch so gut
wie gar nichts dafür. Seine Annuitäten werden gegen
die wertlosesten Sachen umgetauscht. Senator
Neshmith von Oregon sagte einst in einer Rede, daß
er Augenzeuge gewesen sei, wie einem Stamm anstatt
des bestimmten Geldes und der wollenen Decken
vierzig Dutzend Paare elastischer Strumpfbänder geschickt
wurden, trotzdem keiner jener Indianer je vorher
nur einen Strumpf gesehen hatte.
So haben sie also ihre angestammte Heimat verloren,
und das bißchen Wild, das sich noch auf den für
sie reservierten Strecken herumtreibt, wird auch tagtäglich
seltener, denn der verwegene Trapper achtet
keine Grenze, sondern geht hin, wo es ihm gefällt, bestraft
aber jede unglückliche Rothaut, die sich desselben
Verbrechens schuldig macht, unbarmherzig mit
dem Tod oder mit Grausamkeiten, die die der roten
Rasse bei weitem in den Schatten stellen. Denn jene
verwegenen Gesellen, die sich dem unsteten Trapperleben,
das tagtäglich von allen erdenklichen Gefahren
umgeben ist, widmen, schlagen ihr Leben äußerst gering
an und das ihrer roten Brüder natürlich noch viel
geringer.
Alle Indianer stimmen darin überein, daß es, seit
sie mit den Weißen Umgang gepflogen hätten, bedeutend
mehr Diebe, Mörder und sonstige schlechte
Kerle unter ihnen gäbe.
Der Prophet Tecumseh sagte einst in einer Rede:
»Als der weiße Mann seinen Fuß auf unser Land setzte,
war er hungrig und schwach und hatte keinen
Platz, wohin er seine Decke legen, und kein Feuer, an
dem er sie trocknen konnte. Unsere Väter teilten alles
mit ihm; wenn er Hunger hatte, speisten sie ihn, wenn
er krank war, brachten sie ihm Medizin, und wenn es
kalt war, wärmende Felle. Aber der weiße Mann ist
wie die halberfrorene Schlange, die ihren Wohltäter,
der sie in seinem warmen Wigwam aufnahm, heimlich
mit ihrem Gift tötete. Der weiße Mann macht jetzt
Jagd auf uns und verschont weder unsere Kinder noch
unsere Frauen, noch unsere alten, hilflosen Leute.
Gott hat ihm ein großes Land hinter dem Wasser gegeben,
aber er ist mit nichts zufrieden, und nun sucht
er uns aus unserer Heimat zu vertreiben!«
Читать дальше