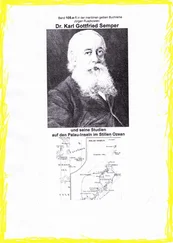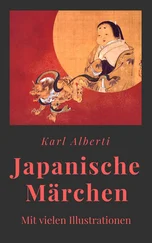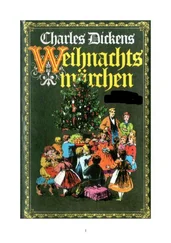Letzteres ist's denn, was den roten Mann zur Ver-
zweiflung treibt und was ihn lehrt, sich zuweilen ähnlicher
Waffen zur Verteidigung zu bedienen. Ein jeder
Weißer aber, der es mit ihm ehrlich, aufrichtig und
human meint, ist mit einem Edelmut, einer Liebe und
einer Aufopferung belohnt worden, die bei den zivilisierten
Völkern zu großer Seltenheit gerechnet werden
müssen. Ich erinnere da nur z.B. an William Penn
oder an den Franzosen Dubuque, Gründer der gleichnamigen
Stadt in Iowa, zu dessen Ehren lange Jahre
nach seinem Tod ein heiliges Feuer unterhalten
wurde; dann an den Pelzjäger Henry, den zur Zeit des
Krieges Pontiacs gegen die Engländer ein Indianer
schnell an Bruders Statt annahm und dann seinen
Häuptling durch reiche Geschenke bewog, ihn als solchen
anzuerkennen und ihm das Leben zu schenken.
Dann erinnere ich noch an den Missionar Dean, dessen
Geschichte ein Pendant zur Pocahontas-Affäre
bildet. Es war nämlich beschlossen worden, ihn zur
Sühnung eines durch ein Bleichgesicht getöteten Indianers
hinzurichten, als plötzlich alle Weiber des
ganzen Dorfes herbeisprangen und einstimmig erklärten,
daß, wenn nur eine rote Hand den Kopf des weißen
Mannes berühre, sie sich augenblicklich ermorden
würden. Dabei zog jede ein verborgen gehaltenes
Messer hervor.
Auch erinnere ich noch an Washington, den die
Irokesen Hänodägänears oder den »Städtezerstörer«
nennen. Als die indianische Medizin oder Religion
ihren Himmel schuf, dachte sie natürlich nicht an das
Bleichgesicht und reservierte ihm daher auch keinen
Sitz; sie fand übrigens auch später, daß es keines solchen
würdig war. Als aber die wilden Söhne die Gerechtigkeit
und die Humanität Washingtons – des
Mannes, den sie schon seit der Schlacht von Monongahela
von einem mächtigen Manitu beschützt glaubten
– kennenlernten, da wurde es ihnen doch bang
ums Herz, wenn sie dachten, daß dieser gute Mann
wohl die ganze Ewigkeit am großen, mit faulen Fröschen
und Eidechsen gefüllten Stinkfluß zubringen
müsse, und ihre Medizinmänner sahen daher schnell
nach und fanden dicht am Eingang des Paradieses
einen wunderschönen Hügel voll schattiger Bäume
und duftender Blumen, und darauf bauten sie seiner
Seele eine trauliche Heimat, die jeder Indianer beim
Eintritt in den Himmel passiert und freundlich begrüßt.
Zur Kälte der Hölle jedoch ist noch kein Weißer
ausdrücklich verdammt worden, trotzdem die Gründe
dafür wohl tausendfach auf der Hand liegen.
In der eigentlichen Zivilisation der roten Rasse auf
praktischem Weg ist in Nordamerika noch soviel wie
gar nichts geleistet worden. Die sich aufopfernden
Missionare mit ihren unzähligen Bibeln in den Händen
und den edelsten Gedanken in den Köpfen, die
vor keiner Mühe noch Gefahr, noch vor der sprachlichen
Herkulesarbeit zurückschreckten, haben aus
vielfachen Gründen auch nicht viel Solides wirken
können; denn abgesehen davon, daß mehrere von
ihnen äußerst borniert und andere wieder sehr spekulativer
Natur waren und mehr Schnapsfässer als heilsame
Ideen einführten, so ist das Christentum wie
eine jede andere europäische oder asiatische Religionsform
das alleruntauglichste Vehikel, eine wilde
Menschenrasse zu veredeln, und das hat sich, denke
ich, an den Indianern am deutlichsten gezeigt.
Das Christentum hat sich einmal überlebt; der
zweitausend Jahre alte Ideengang eines fremden Volkes,
der fremden Verhältnissen, Gesetzen, politischen
und sozialen Umständen entwurzelt ist, wirkt auf eine
unter ganz anderen Ansichten groß gewordene Nation
wie die Temperatur der arktischen Zone auf ein Tropengewächs.
Sowenig dem Indianer eine fein gebügelte Hose,
eine künstlich gestickte Weste oder ein kostbarer Biberhut
von Wert sein kann und sowenig feine Möbel,
Sofas und Pianos in seinen Wigwam passen, so wenig
passen die biblischen Absurditäten in seinen Kopf.
Wie er seine eigenen Kleider hat, so hat er auch seine
eigene Religion, seine religiösen Feste, seine Gebete,
seine Sintflut, seine Manitus und seine Götter, die er
sich so leicht nicht nehmen läßt. Eine christliche Got-
tesanschauung ist ihm noch lächerlicher wie uns die
seinige.
Auch ist seine Brust voll des begründeten Erbhasses,
der ihn lehrt, alles von den Weißen Kommende
mit der größten Vorsicht und Bedachtsamkeit zu erwägen,
ehe er sich entschließt, sich etwas davon zu
eigen zu machen. »Denn«, sagte einst ein Häuptling,
»der weiße Mann ist nicht mit guten Absichten in
unser Land gereist, und das Buch, das er mitgebracht
hat und von dem er sagt, es enthalte Gottes Wort, ist
nicht für die Indianer gemacht. Gott hat uns seine Gebote
in den Kopf geschrieben und unseren Vorvätern
gesagt, wie wir ihn ehren sollen, damit er uns immer
Wild schicke. Wenn wir aber dem weißen Mann und
seinem Buch folgen und unsere alten Sitten vergessen,
so werden wir, wie die Erfahrung zeigt, elend und
arm, und unsere Schutzgeister werden uns weinend
den Rücken kehren. Dann werden wir immer tiefer
und tiefer sinken und zuletzt wie er mühsam Kühe
melken und Korn pflanzen müssen!«
Eine andere Unterhaltung, die uns Conrad Weiser,
ehemals Dolmetscher bei den sechs Nationen, mitteilt,
liefert uns ebenfalls eine treffende Charakteristik des
allgemeinen Argwohns, mit dem der Indianer die
christliche Kirche ansieht.
Conrad Weiser hatte einst eine Botschaft nach Onondaga
im Staat New York zu bringen und traf dabei
unterwegs eine ihm befreundete Rothaut, mit der er
sich einige Stunden unterhielt. »Conrad«, sagte der
Indianer, »du hast lange unter den Weißen gelebt und
kennst auch ihre Sitten. Ich habe, wie du weißt, mich
häufig längere Zeit in Albany aufgehalten und dort
bemerkt, daß sie sich regelmäßig alle sieben Tage einmal
in einem großen Haus versammeln; kannst du mir
nicht erklären, was sie darin tun?«
»O ja«, erwiderte Weiser; »sie versammeln sich
dort, um gute Dinge zu hören und ihrem Gott zu danken
und zu dienen.«
»Ich zweifle nicht daran, Conrad, daß sie dir das
gesagt haben, denn sie haben mir dasselbe gesagt;
aber ich bezweifle dessen Wahrheit und will dir nun
meine Gründe mitteilen. Ich war kürzlich wieder einmal
in Albany, um meine Häute zu verkaufen und
Messer, Decken usw. dafür einzutauschen. Du kennst
doch Hans Hanson dort; zu dem ging ich und fragte
ihn, wieviel er für das Pfund Biber geben könne.
›Vier Schilling‹, erwiderte er und fügte hinzu, daß er
aber jetzt keine Geschäfte machen könne, da er in die
Kirche gehen müsse.
Nun, dachte ich bei mir selbst, wenn du jetzt keine
Geschäfte machen kannst, so gehst du einmal mit
ihm; und ich tat es denn auch. In der Mitte des Hauses
stand ein kohlschwarz angezogener Mann, der schien
von sehr wichtigen Dingen zu reden, wobei er stets
auf mich blickte. Da ich mir einbildete, er ärgere sich,
mich hier zu sehen, so ging ich hinaus und setzte
mich vor die Tür und zündete meine Pfeife an. Darauf
hörte ich ganz deutlich, wie jener Mann ständig von
einem Biber sprach. Als die Kirche aus war und die
Leute wieder nach Hause gingen, fragte ich Hans, ob
er mir nicht mehr als vier Schilling geben könne.
›Nein‹, antwortete er barsch, ›ich hab's mir überlegt
Читать дальше