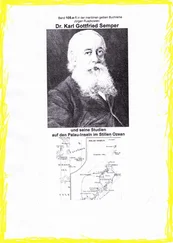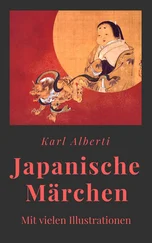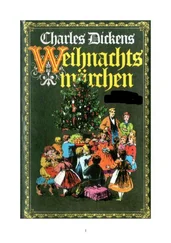sein, wenn er seine mühsam fabrizierte Welt
mit allem, was darauf kroch und flog, wieder so
leichtsinnig zerstört habe.
Als nach einer mexikanischen Erzählung die Erde
durch den Wassergott Tlalok unterging – eine Episode,
die das sogenannte »vierte Weltalter« bildet –,
entging nur der alte Fischgott Coxox mit seiner besseren
oder schlechteren Hälfte den Fluten, und ein Kolibri
zeigte ihnen später durch einige mitgebrachte
Zweige an, daß sich die Erde wieder reorganisiere.
Das bei den Karaiben gerettete Menschenpaar bevölkerte
die Erde wieder dadurch, daß es Steine hinter
sich warf, die sich augenblicklich in Menschen verwandelten
(s. Deukalion und Pyrrha).
Bei den Muyscas, die die Terra firma bewohnen,
wurde die Sintflut durch ein böses Weib verschuldet,
und wenn ihr dreihäuptiger Mann nicht schnell den
Wasserfall von Tequendana geschaffen hätte, so daß
das Wasser abfließen konnte, so wären sicherlich alle
Menschen ertrunken. Die Komantschen in Texas
glauben, sie seien deshalb dem Ertrinken entronnen,
weil sie der Große Geist noch zur rechten Zeit in
weiße Vögel verwandelt habe.
Bei einigen Indianerstämmen herrscht der Glaube,
daß die Welt das nächstemal durch Feuer untergehen
werde, ein Malheur, das die Brasilianer und die Mexikaner
bereits glücklich überstanden haben.
Große Aufregung herrscht jedesmal bei einer Sonnen-
oder einer Mondfinsternis, denn einige glauben,
der betreffende Körper sei krank und wolle sterben.
Einige glauben auch wie die Chinesen, ein böser
Geist wolle ihn verschlingen, weshalb sie einen fürchterlichen
Lärm machen, um diesen zu verscheuchen.
Hunde werden losgebunden und geprügelt und alle
Donnerbüchsen abgeschossen. Plutarch erzählt, daß
auch die Römer bei ähnlichen Gelegenheiten zu demselben
Zweck eherne Gefäße gegeneinander schlugen.
Kurios sind die Ansichten einiger Indianerstämme
hinsichtlich ihres Lebens nach dem Tod. Sie stimmen
nur in dem Punkt überein, daß die Hauptseele des
Guten ein prächtiges, sonniges Land voll des fettesten
Wildes erwartet; der Weg dahin führt teils über die
Milchstraße, teils über die große »medizinene« Prärie.
Wir sagten eben die Hauptseele, und das mit Absicht,
denn manche Indianerstämme schreiben sich mehrere
Seelen zu. Die Dakotas glauben deren vier zu haben,
wovon die erste ins Reich der Geister oder ins Paradies
gehe und die zweite die Luft bewohne; die dritte
müsse den Kadaver bewachen und die vierte ständig
ihr heimatliches Dorf umschweben.
Bei den Stämmen der Algonkin-Familie begnügt
sich jeder Indianer mit zwei Seelen: einer körperlichen
und einer geistigen; sie nageln deshalb auch nie
ihre Särge zu, so daß die eine immer bequem aus und
ein gehen und der anderen Nahrung bringen kann.
Daß überhaupt jeder Mensch zwei Seelen habe, suchte
ein alter Indianer einst am Träumen zu beweisen;
während nämlich die eine Seele durch Feld und Wald
streife, bleibe die andere ruhig beim Körper zurück,
denn sonst würde der ja während dieser Zeit sterben.
Der meisten Seelen rühmen sich die Karaiben:
jeder Pulsschlag ist nämlich eine. Sie haben Seelen
der Augen, der Nase, der Füße, der Hände usw., von
denen aber nicht alle selig werden.
In der alten Tragödie »Pontiac«, wahrscheinlich
von William Rogers verfaßt, gibt es zwei Trapper,
von denen der eine dem Indianer gar keine Seele zuspricht:
ORSBOURN:
I fear their ghosts will haunt us in the dark.
HONNYMAN:
It's no more murder than to crack a louse,
That is, if you 've the wit to keep it private.
And as to haunting Indians have no ghosts,
But as they live like beasts, like beasts they die.
I've killed a dozen in this selfsame way,
And never yet was troubled with their ghosts.
ORSBOURN:
Then I'm content, my scroupels are removed.
Für die Seelen sorgen einige Indianer recht ängstlich.
Die Dakotas hängen rings um den Leichnam Speise
auf und lassen mehrere Tage lang ein Feuer dabei
brennen, damit jene weder frieren noch Hunger leiden.
Kindern wird ihr Spielzeug beigegeben, und die Verwandten
kommen häufig zum Totengerüst, um sich
mit der dabei zurückgebliebenen Seele zu unterhalten.
Die Algonkins fangen, wenn einer von ihnen gestorben
ist, einen Vogel, der dessen Seele in den Himmel
tragen muß.
An die sogenannte »Seelenwanderung« glauben
nicht alle Stämme. Die Algonkins behaupten, vor
ihrer Geburt Tiere bewohnt zu haben, weshalb sie
diese auch für vernünftig und verständig halten. Einige
Odjibwas geben vor, einem Hundefell entsprungen
zu sein, und die Bucros hoffen nach dem Tod in Affen
verwandelt zu werden. Gewisse Stämme in Kalifornien
essen nie Fleisch von großen Tieren, da sie befürchten,
es enthielte den Geist irgendeines Menschen.
Viele essen von Tieren, die sie aus dem ge-
nannten Grund in Ehrfurcht halten, nicht von der
rechten Seite oder nicht vom Kopf oder nicht die
Leber usw.
Zum weiteren Seelenleben der Indianer gehören
auch noch die »Ahnungen«. Der Aberglaube eines
jeden Volkes und eines jeden Landes denkt überall
jedes bedeutende soziale wie politische Ereignis in irgendeiner
Weise vorausgesehen zu haben. Hat ein
altes Weib einen außergewöhnlichen Traum gehabt;
hat ein grimmiger Köter eine ganze Nacht hindurch
ohne bekannte Ursache gebellt; ist ein Nordlicht erschienen
oder hat sich sonst ein gerade nicht alltägliches
physikalisches Phänomen blicken lassen, und
das philiströse Stilleben wird plötzlich mit Krieg,
Hungersnot oder Pestilenz heimgesucht, so unterliegt
es natürlich keinem Zweifel, daß die vorhergegangenen
Zufälligkeiten die untrüglichsten Vorboten jener
Kalamitäten waren. So haben die Indianer geradesogut
ihre schlimmen Omina vom Untergang ihrer Nation
wie zu ihrer Zeit die Etrusker, die Römer und die
Türken.
Im Oktober 1762 – also kurz vor Beginn des blutigen
Pontiacschen Krieges – will man über Detroit
mehrere kohlschwarze Wolken gesehen haben, deren
Regen nach Schwefel roch und eine tintenartige Farbe
hatte, so daß die Leute damit schreiben konnten. Ehe
der sogenannte »König-Philipps-Krieg« (King Phil-
ipp's war) anfing, hörte man in der Plymouth-Kolonie
häufig schweres Kanonengerassel in der Luft, hörte
Flinten abfeuern und den Lärm der Trommeln, ohne
jedoch etwas zu sehen. Bei den Indianern zu Columbus'
Zeiten deuteten alle derartigen Vorzeichen auf die
Ankunft der Spanier hin.
Das Sterben soll bei einigen Indianerstämmen wie
bei den Griechen durch die Ungehorsamkeit der Weiber
eingeführt worden sein, wie denn überhaupt diese
als die Quelle allen Elends gelten müssen, das die
Rothaut das Leben hindurch verfolgt. Kein Wunder
also, daß die Vergrößerung einer Familie durch ein
Mädchen quasi als ein Unglück gilt, wenn der Indianer
auch nicht so inhuman damit verfährt wie der
Hindu, der es auf den Markt trägt und mit der einen
Hand feilbietet und in der anderen ein Messer hält,
um es für den Fall, daß sich kein Liebhaber dafür findet,
gleich erstechen zu können.
Viele Kinder zu besitzen ist der indianischen
Squaw unangenehm, und das aus sehr triftigen Gründen:
Bei ihrem ständigen Wanderleben ist sie der alleinige
Packesel, der sie mühsam mitschleppen muß,
Читать дальше