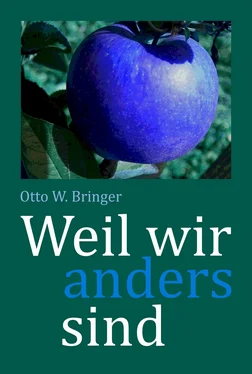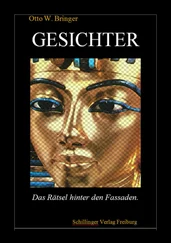Wir hatten nie Gebetbücher, nur eine Bibel. Lieder, «Vaterunser» und «Gegrüßt seist du Maria» kennen wir auswendig. Auch in Deutsch. Bleiben wir länger an einem Ort, lernen wir als erstes die Sprache der anderen. Irgendein Bettler findet sich immer, der sie uns beibringt. Wir bedanken uns bei ihnen und laden sie zum täglichen Essen ein. Bis wir die neue Sprache verstehen und uns verständigen können. So ist allen geholfen.
Die Pfarrer am Ort waren froh, wenn wir regelmäßig in die Sonntags-Messe kamen und kommunizierten. Erinnere mich, als eines Tages meine Mama zu mir sagte: „Du darfst hier nicht in die Schule gehen, also auch nichts lernen von Gott und seiner Kirche. Deshalb lese ich Dir aus der Bibel die Geschichte vom Abendmahl vor. Das wichtigste bei uns Katholiken. Es war Jesus letztes Essen mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde.“
Eine Geschichte, die mich anfangs faszinierte. Aber nicht lange danach rätselhaft vorkam. Brot der Leib Christi? Wein sein Blut? Gott ein Mensch, einer von uns? Und wir sollen diesen Jesus essen? Schon komisch. Mama las damals unbeirrt weiter: „Jesus gab beides seinen Jüngern und sagte: „Das ist mein Leib und mein Blut. Esset und trinket, damit ich in Euch bin“.
Ich weiß, in jeder Messe wird dieses Abendmahl wiederholt, uns zu erinnern, dass dieser Jesus gegenwärtig ist. Mama damals: „Du wirst es später richtig verstehen.“ Ließ mich taufen, als ich zehn war. Kurz danach zur ersten Heiligen Kommunion gehen. Glaubte damals an alles, was mit Orgel und Weihrauch gefeiert wurde.
Heute ist die Wandlung in der Messe für mich weder Wirklichkeit noch Zauberei, sondern Symbol für die Gemeinschaft aller, die es glauben. Ich bin zur Kommunion gegangen, sagen sie, schluckten sie in der Messe eine Hostie. Und fühlten Gott in sich. Las in einem Lexikon, Kommunion ist abgeleitet aus dem lateinischen «Communio». Bedeutet Gemeinschaft. Mit wem? Gott? Sind es nicht Menschen, die mit anderen Gemeinschaft haben? Oder sogar beide? Glauben ist eine komplizierte Sache.
Sehe mich um, erkenne Leute, denen ich schon im Dorf begegnete. Da, die Frau vom Obststand auf dem Wochenmarkt. In der zweiten Bank links außen sitzt sie, sieht sich um. Wie Frauen sich umdrehen, um festzustellen, wer hinter ihnen sitzt. Rasch, damit es nicht so auffällt. Erkennt mich, stößt ihre Nachbarin an. Auch die wirft einen raschen Blick zu uns herüber und flüstert irgendwas. Alle scheinen zu flüstern. Wie an einer Strippe gezogen schauen alle Frauen auf dieser Bank zu uns herüber. Freundlich sind ihre Blicke nicht.
Ehe ich mir einen Reim darauf mache, stolzieren drei Männer im Mittelgang an uns vorbei. Nebeneinander, Schulter an Schulter, sodass sie die Breite des Ganges einnehmen. Als wollten sie niemanden durchlassen. Wie die vereinten Truppen General Fochs im letzten Krieg. Den Blick starr geradeaus gerichtet. Würdigen uns keines Blickes, als wären wir Luft. Alle anderen grüßen sie, nicken mit dem Kopf, lächeln. Man kennt sich. Die erste Bank auf der rechten Seite reserviert für sie. Ihr Name auf Emaille-Schildern.
Die Frauen der zweiten Bank links blättern wieder in ihren Büchern, viele mit goldenem Schnitt. Drehen sich hin und wieder um zu uns. Scheinen es nicht fassen zu können, dass wir in ihrer Kirche sind. Was ist das bloß für ein Pfarrer, der Zigeunern die Türe zum Himmelreich öffnet?
Bing bing, einer der beiden Messdiener zieht am Seil neben der Tür. Das Glöckchen läutet. Messe beginnt. Der Pfarrer im grünen Messgewand schreitet. Seine Hände halten den Kelch, den ein Tuch verhüllt. Heute ist es grün, wie das Messgewand. In der Fastenzeit sind beide violett, Pfingsten und Karfreitag rot. Wie bei uns zuletzt noch in Wien. Schwarz bei Trauergottesdiensten. Es ist ein älterer Herr, der Pfarrer der Gemeinde Sankt Bonifatius. Scheint gut genährt zu sein. Sein Bauch bauscht das Gewand auf, als blies es einer von unten auf. Zögert, bevor er die erste Stufe zum Altar hinauf riskiert. Drei sind es, jede bestimmt zwanzig Zentimeter hoch. Hoffentlich stolpere ich nicht, scheint er zu denken.
Die beiden Knäblein in schwarzem Talar und weißem Spitzenrock sind an ihre Plätze gegangen. Rechts einer und links einer. Zu ebener Erde. Kein Risiko zu stolpern und zu stürzen. Wie in der Politik fällt mir ein: Die Oben können stürzen oder gestürzt werden. Die Unten allenfalls im Schlamm stecken bleiben.
Orgel ertönt. Das Größte im Gottesdienst. Musik, die klingt, als hätte der Himmel alles, was Töne von sich gibt, in aberhundert Pfeifen gesteckt. Um es wie ein Füllhorn über uns auszuschütten. Die Gemeinde zu bewegen, in das Lob Gottes einzustimmen. Der jeden Menschen liebt, ob seine Haut hell, dunkel, rot oder gelb ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es in den Evangelien. Duldeten sie uns nach dem Gottesdienst am Nebentisch im Café, wäre ein Anfang gemacht und Mama glücklich.
Doch hier kommt keine Freude auf. Einzelne Frauen beginnen mit ihren hohen Stimmen. „Großer Gott wir loben dich“ müsste anders klingen. Zögernd, als müssten sie sich erst einsingen. Nacheinander stimmen andere ein. Wir kennen die Texte nicht, nur die Melodie gehört, behalten und mitgesummt. Noch aber fehlen die kräftigen Stimmen der Männer. Gehen als letzte hinein und verlassen als erste das Haus Gottes. Lassen ihre Stimmen erst hören, als die Frauen bereits auf der Höhe ihrer Gesangskunst angelangt sind. Und es schon ganz schön geklungen hat.
Nicht anders am Schluss der Messe. Tenöre schmettern, Bässe brummen die letzte Strophe des Liedes vom Lob Gottes. Froh, alles hinter sich zu haben. Als gleichzeitig die Glocken über uns die Mauern zittern lassen: Schluss, aus, raus mit euch. Heute scheint etwas schief zu gehen. Noch nicht aus der Portalhalle heraus, geifern uns Frauen an:
„Was fällt euch Zigeunerpack ein, in unsere Kirche zu gehen? Und auch noch zur Kommunion. Verschwindet dahin, wo ihr hergekommen.“ Fuchteln mit den Händen, als wollten sie uns schlagen. Ihre Männer mischen sich ein, zwei, drei werden handgreiflich. Drücken alles, was dunkle Haut hat. Roma, Männer und Frauen, vor sich her. Sogar einen Jungen, der braun gebrannt aus den Ferien zurück. Keiner von uns. Packen meinen Vater an der Schulter. Schubsen ihn, dass er bald hingefallen wäre. Schieben meine Mutter hinterher und mich. Da packt mich der Zorn, regelrechte Wut. Noch nie hatte ich Roma verteidigen wollen, aber jetzt platzt mir der Kragen:
„Sie wollen Christen sein? Sehe es Ihren Gesichtern an, am liebsten verprügelten Sie uns, jagten uns aus dem Dorf auf der Stelle. Vom Kirchplatz direkt in die Hölle. Ja, in die Hölle wünschen Sie uns.“
„Was ist hier los?“ Der Pfarrer eilt herbei, vom Geschrei angelockt. Blickt die Männer an. Dann zu uns herüber. Verstehen huscht über sein Gesicht. Und ein Minimum vom Minimum eines Lächelns. So hatte ich ihn nicht gesehen an diesem Sonntagmorgen. Sein weites Gewand vom schnellen Gehen aufgewirbelt. Weiter noch als am Altar. Flügeln eines Erzengels gleich, als er die Hände hebt wie zu segnen. Sankt Michael persönlich. Was wird er jetzt sagen?
„Diese Männer und Frauen sind Christen, römisch- katholisch wie Ihr. Eure Schwestern und Brüder, auch wenn sie Roma sind. Eine dunklere Haut haben als wir, unsere Sprache nicht perfekt sprechen. Liebet einander, sagt der Herr. Und spottet nicht, weil sie anders aussehen. Wollt sie um Gottes Willen nicht verjagen, wie Ihr Füchse verjagt, die eure Hühner stehlen. Denn sie glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, wie Ihr.“ Nach einer winzigen Pause: „hoffe ich jedenfalls.“
Kommt auf uns zu, das Gewand wieder ordentlich von der Schulter heruntergefallen. Umarmt meine Mama. meinen Papa, mich, die Freunde. Lauter, dass alle es hören: „Ich lade Euch ein zu einem Glas Wein in meinen Garten. Jetzt auf der Stelle.“ Kirchschlager und Kirchschlagerinnen betroffen, schweigen, verdrücken sich. Männer, wie ich sehe, ins Wirtshaus nebenan, ihren Ärger hinunter zu spülen. Frauen, wie es ihre Art ist, tuscheln noch miteinander allerlei über Fremde und Nächstenliebe. Ob ʼs positive Folgen hat für uns? Keine Ahnung.
Читать дальше