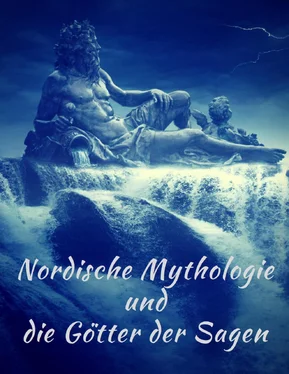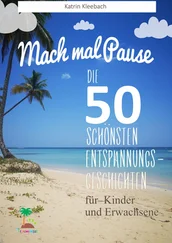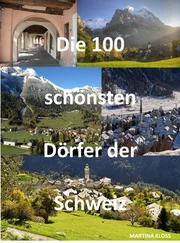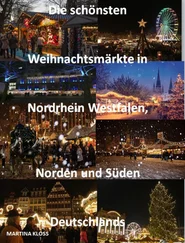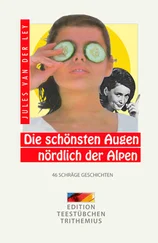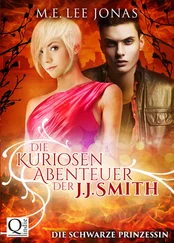Die Brücke, welche nach der Unterwelt führt durch Steinklüfte, wird von der Riesin Môdgudr (Seelenstreit) bewacht. Sie ist eine Anklägerin; als Brunhild den Ritt nach Hel tut, wehrt ihr die Riesin den Weg, indem sie ihr die während ihres Lebens auf der Erde begangene Schuld vorhält.
Eine Göttin der Schrecken, die Riesin der grausigen Tiefe, welche alles Leben hinabschlürfen will, ähnlich wie die Wasserriesin Ran die Ertrinkenden, wurde Hel wohl erst später, nachdem ihre wohltätigen Seiten in der Erbgöttin Nerthus oder Jörd sowie in Frigg besonderen Ausdruck gefunden hatten. Als böse Unholdin schildert sie eine offenbar jüngere Darstellung; ihr Saal heisst Elend, Hunger ihre Schüssel, ihr Messer Gier, ihr Knecht Gangträge, ihre Magd Ganglässig, ihre Schwelle Einsturz, ihr Bett Kummer, ihr Vorhang drohendes Verderben; sie ist nur zur Hälfte menschenfarb, zur andern Hälfte schwarz (schwarzblau, blâ); also kenntlich genug durch ihr furchtbares Aussehen.
Vielleicht aber waren früher neben jenen Straforten in Hels Reich auch Räume seligen Aufenthalts gedacht, welche erst später ausschliessend nach Asgard verlegt wurden, wobei dann das Fortleben in Hel auch für Schuldlose nurmehr als ein freudloses, schattenhaftes gedacht wurde, nachdem der vergeistigte Odin und sein Walhall in den Vordergrund getreten waren. Wenigstens würde jene Annahme am besten erklären, dass Sagen und Märchen im Reiche der Unterwelt, im Schoss der Berge, in Höhlen, unterhalb der Seen und Teiche anmutreiche Gärten, blumige Wiesen, goldene Säle kennen, in welchen die Seelen der schuldlosen Abgeschiedenen ein frohes Dasein führen; wird doch auch für Baldur festlicher Empfang in Hels geschmücktem Saal bereitet.
Die segensreiche Wirkung Hels allein wird hervorgehoben, wenn sie mit der Erbgöttin Jörd (südgermanisch: Nerthus) als eins gedacht und daher – als solche – mit Odin vermählt wird; sie gebiert ihm als Jörd Thor, als Hel Widar (s. diesen unten). Daher heisst es auch, dass Odin ihr Gewalt über die neunte Welt (eben über die Unterwelt)gegeben habe. Als heilige, segensreiche, allnährende (Nerthus von narjan, nähren) Mutter wurde die Erbgöttin (terra mater) von suevischen Völkern an der Nordseeküste verehrt; sie hatte ihren Wohnsitz auf einem Eiland des Meeres; in einem keuschen Haine ward ihr heiliger Wagen, von faltenreichem Gewande verhüllt, aufbewahrt; nur ihres Priesters Hand durfte rühren an das geheimnisvolle Gefährt. Dieser erkennt es, wann die Göttin das Heiligtum betritt; alsbald werden die ihr geweihten Kühe angeschirrt, und in Ehrfurcht begleitet er den feierlichen Zug. Denn nun fährt die Göttin unter die Völker und greift ein in die Geschicke der Menschen; zur Zeit des frühesten Frühlings (Februar oder März). Da hebt an eine Reihe festfroher Tage; alle Stätten, welche sie des Einzugs und der Gastung würdigt, werden Festplätze. Dann ruhen die Waffen, keine Kriegsfahrt wird unternommen, eingeschlossen wird alle Eisenwehr; Friede und Ruhe kennt man in jenen Tagen, liebt man in jenen Tagen allein, bis die Göttin des Verkehrs mit den Sterblichen ersättigt ist und derselbe Priester sie zurückgeleitet in ihr Heiligtum. Alsbald werden Wagen, Gewande und, nach dem Glauben, die Gottheit selbst in einem geheimnisvoll abgelegenen See gebadet. Unfreie, welche dabei Dienste leisten, verschlingt sofort dieselbe Flut. Daher waltet geheimes Grauen und eine bedeutungsvolle Rätselhaftigkeit; denn, was jenes Verborgene sei, das wissen nur dem Tode Geweihte. Diese Schilderung des Tacitus (Germania c. 40) zeigt die Erdgöttin als eine Mutter der Freude, des Segens, des Gedeihens, des Friedens, wann sie unter die Völker fährt; aber die düsteren Menschenopfer, die der geheimnisvolle See verschlingt, deuten an, dass sie zugleich die Göttin des Todes und der Unterwelt war.
Der Wagen der Göttin war vielleicht zugleich als Schiff gedacht; (in Italien »Caroccio«, ein Wagen, der oft ein Schiff oder doch einen Mastbaum trug) – schon um von jener Insel das Festland zu erreichen. Unter dem Bild eines Schiffes, d. h. richtiger wohl auf einem Schiff, hielt eine Göttin der Fruchtbarkeit, welche von den Römern der ägyptischen Isis verglichen ward, Umzüge. Solche festliche Umfahrten, zur Zeit, da der Winter dem sieghaft einziehenden Frühling weicht, – ungefähr um Fastnacht– mit der Bedeutung, Freude und Frieden zu verbreiten, waren häufig und haben sich in manchen Landschaften bis heute erhalten.
Gerade von dem Festdienst dieser der Isis vergleichbaren Göttin der Ehe, des Friedens, der Fruchtbarkeit, daher auch des Ackersegens und der Schiffahrt, haben sich zahlreiche Spuren erhalten. Aventin erzählt von einer Frau Eisen, welche den König Schwab in Augsburg Eisen schmieden gelehrt habe und pflügen, säen, ernten, Flachs und Hanf bauen, die Weiber aber spinnen, weben, nähen, Brot kneten und backen; mit Schiff, Pflug und Wagen zog sie durch die Gaue. Zu Nivelles wird noch der Wagen einer solchen Göttin, der heiligen Gertrud, aufbewahrt, welche gegen Mäusefrass schützte; mit einer Maus am Stab oder Rocken wird sie abgebildet. Man trinkt Sankt Gertruds Minne wie der heidnischen Götter, und zwar aus einem Becher, der ein Schiff darstellt. Denn auch die Schützerin der Schiffer ist sie; die Rheinschiffer beten in der Kapelle der heiligen Gertrud in Bonn um gute Fahrt; sie bringt die schöne Jahreszeit, »d. h. sie holt den kalten Stein aus dem Rhein«. Die Gartenarbeit wird nun wieder möglich: »Gertrud (= Freya-Gerda) ist die erste Gärtnerin«; d. h. an ihrem Tag (17. März) weicht die Kälte der Frühlingswärme. Gertrud, die »Speer-traute«, ist übrigens ein Walküren-Name; sie entspricht Freya; daher auch verbringen alle Seelen Verstorbener die erste Nacht in Sankt Gertruds Saal, die zweite bei Sankt Michael, die dritte erst in Himmel oder Hölle; es ist Freya, welche sich mit Wotan (= Sankt Michael) in die Seelen der Verstorbenen teilt. Auch ist Sankt Gertrud wie einer heidnischen Göttin ein Waldestier heilig: der rothäubige Schwarzspecht (picus martius) der auch »Martinsvogel« heisst, weil er Sankt Martin d. h. Wotan geweiht ist. Derselbe war bei den Italikern ein verzauberter König, Picus, ein Waldgeist, als Vogel aber dem Kriegsgott Mars geweiht, was vielleicht auch auf Sankt Martin (mit Schwert und Mantel) hinführt.
Der Gemahl der Nerthus war nicht Odin, sondern wahrscheinlich ihr Bruder Niördr, welcher sie verlassen musste, als er, aus dem Verbande der Manen scheidend, unter die Asen aufgenommen wurde; denn Geschwisterehe, welche, wie bei andern nordischen Völkern, auch bei Germanen in ältester Zeit vorkam, galt den Asen, d. h. dem vorgeschrittenen Bewusstsein, welches die Asen-Religion geschaffen, nicht mehr als erlaubt.
VIII. Freya und Frigg.
Freya, die Wanengöttin, war vermählt mit Odr; als sie diesen verlor, weinte sie ihm in treuer Liebe Sehnen goldene Tränen nach. Odr wird von einigen als Freyr gedacht, welcher die Schwester bei ihrer beider Aufnahme unter die Asen nicht mehr habe als Gemahl behalten dürfen, von andern als Odin, der in den »zwölf Nächten« (von Weihnachten bis Dreikönige) als wilder Jäger in dem Sturmbrausen jener Zeit um die Frühlingsgöttin, die schöne Jahreszeit, wirbt, aber schon bald, zur Zeit der Sommersonnenwende, von dem Hauer eines Ebers getroffen, stirbt; d. h. nur in seiner Bedeutung als Gott des aufsteigenden Jahres; ähnlich seinem Sohne Baldur. Daher wird auch der Hackelberend (d. h. Mantelträger, d. h. Wotan), der im Mittelalter als wilder Jäger Wotan vertritt, durch einen Eber getötet und hat nun in alle Ewigkeit zu jagen, weil er sich, frevlen Sinnes, statt der himmlischen Seligkeit ewige Weidmannslust gewünscht hatte.
Bald aber ward nicht mehr Freya als Gemahlin Odins gedacht, sondern Frigga; Freya, die zur Naturgrundlage die schöne Frühlingszeit hat, ward nun zur Göttin der Liebe, sowohl der edeln als (zumal später) der sinnlichen, leidenschaftlichen Liebe; wenigstens werden ihr von Loki und der Riesin Hyndla derartige Vorwürfe gemacht.
Читать дальше