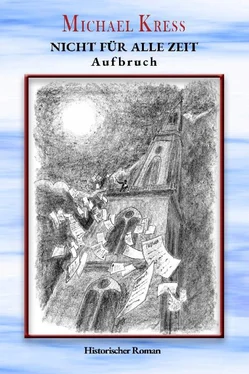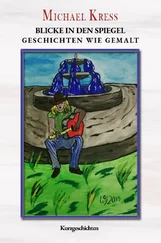Der Empfangschef staunte, als sie so die Treppe herunterkam. Eleonore lächelte ihn an und schon stand sie auf der Straße. Für einen Moment blieb sie stehen und bewunderte das königliche Schloss, das schräg gegenüber hinter einer Häuserzeile in die Höhe wuchs. In der Nacht hatte es geregnet, jetzt sandte die Sonne warme Strahlen. Der Frühling nahte.
Eleonore ging schnellen Schrittes die Straße entlang. Was Vater dazu sagen würde, wenn er sie so sehen könnte? Würde er bereuen, ohne eine Anstandsdame nach Berlin gereist zu sein? Ihre Eltern hatten sie ohne Zwänge erzogen und den Part der Aufpasserin selbst übernommen oder Maria damit beauftragt, ein Auge auf sie zu werfen. Die gute Maria. Ihre erste Komplizin.
Eleonore blieb mehrmals stehen, um sich zu orientieren. Auf der langen Reise hatte sie stundenlang einen Berliner Stadtplan studiert. Die Armenviertel lagen gar nicht so weit vom Schloss entfernt. Linker Hand lag der sogenannte Lustgarten, eine parkähnliche Anlage, die sehr an den Stuttgarter Schlossplatz erinnerte. Doch die Straßen kamen ihr viel weitläufiger vor. Und deutlich lebhafter. Alle paar Meter musste sie anderen Passanten ausweichen oder stehenbleiben, weil ein Fahrzeug ihren Weg kreuzte. Sie überquerte die Spree und hielt sich links. Die Häuserfronten rückten näher zusammen.
Vor einem Haus saß ein Mann auf einer Bank, zwischen seinen Oberschenkeln ein Gefäß eingeklemmt. Mit einem Hammer schlug er auf das Teil ein, wendete und drehte es dabei.
»Kesselschmied Frasunkewic«, stand auf einem windschiefen Schild über dem Eingang. Das »Klang, klang, klang« begleitete Eleonore ein ganzes Stück. Dann versperrte ihr ein Holzstamm den Weg. Der lag auf zwei Balken quer zur Straße. An seinem linken Ende sägten zwei Männer ein Stück ab. Ihre Ärmel hatten sie hochgekrempelt. Wie Eugen, wenn er Zuhause Brennholz sägte. Eleonore wich auf die Straße aus. Sägemehl knirschte unter ihren Stiefeln, als sie die beiden passierte.
Sie erreichte das Hamburger Tor. Im Grunde war es gar kein Tor. Zwei Obelisken ragten links und rechts in die Höhe. Ab da begann die Gartenstraße. Eleonore blieb stehen und hob den Kopf. Dort standen die Familienhäuser, von denen Bettina in ihrem Armenbuch geschrieben hatte.
Kinder spielten vor einem mehrgeschossigen, langgestreckten Haus. Langsam ging sie weiter. Die Straße wurde uneben, und anstatt fest gemauerter Häuser standen da Bretterbuden, die stützend aneinander lehnten. Vereinzelt gab es Freiflächen. Das matte Grün des Grases malte ein wenig Farbtupfer in die ansonsten triste Umgebung.
Sie ging weiter, passierte eine Destillation, vor der ein paar Männer standen und laut miteinander sprachen, blieb dann an der nächsten Querstraße stehen und blickte zurück. Die Familienhäuser ragten wuchtig hervor. Fast so wie das Schloss, überlegte sie. Und doch war es etwas völlig anderes. Eleonore schluckte. Sie überquerte die Straße und ging die andere Seite zurück. Ihr Herz pochte mehr und mehr, je näher sie dem Familienhaus kam.
Direkt vor dem Eingang saß ein Junge. Mit einem Stecken stocherte er im Unrat der Straße. Sie starrte für einen Moment auf sein linkes Bein. Eine Lederkappe stak auf dem Knie, der Fuß fehlte. Sie wollte in ihre Geldbörse greifen, dem Jungen ein paar Münzen geben, als der seinen Kopf hob und sie ansah. Eleonore senkte ihren Blick und hastete an ihm vorbei in das Haus.
Der Geruch nach Essig und billigem Wein nahm sie in Empfang. Finstere Korridore führten nach links und rechts, ein Treppenhaus verlor sich im Dunkeln. Aus den Wohnungen hörte sie gedämpft Stimmen.
»In ihren angenehmen Gesichtszügen liegt viel Kummervolles.« Eleonore fiel diese Passage aus Frau von Arnims Armenbuch ein. Gartenstraße 92 a, Stube 71. Wo sollte sie anfangen, wo aufhören?
In Bettina von Arnims Buch stand eine Aufstellung, wonach vier Personen für ihr Essen, Brennholz und ein bisschen Tabak täglich sechs Silbergroschen benötigten. Sie wollte ein paar der Familien aufsuchen und ihnen zehn Silbergroschen geben. Ihnen einen sorgenlosen Tag schenken.
Einen Tag.
Sie wollte keine Almosen verteilen. Darum hatte sie dem jungen kein Geld zugesteckt. Sie hatte einen Plan. Langsam ging sie den Flur entlang, der von einer öligen Funzel schwach erleuchtet wurde und las die Namen auf den Türschildern. Würde sie auf die treffen, von deren Schicksal sie gelesen hatte? ›Schneidermeister Jablonski‹ stand auf einem Schild.
Eleonore blieb stehen, holte noch einmal Luft. Es ist egal, wo ich beginne , dachte sie und klopfte an. Sie musste ein zweites Mal klopfen, bis jemand die Tür einen Spalt öffnete.
»Wer da?«, fragte eine krächzende Stimme.
»Mich schickt meine Herrin«, log Eleonore. Die Menschen sprachen eher mit ihr, wenn sie sie auf der gleichen gesellschaftlichen Stufe wähnten. So ihr Gedanke.
Ein buckliger Mann mit schütterem Haar trat in den Flur. Linkisch sah er schnell nach links und nach rechts.
»Kommen Sie herein«, bat er dann. Und fügte hinzu: »Ich dachte es sei der Hausverwalter wegen der Miete.«
Eleonore betrat die Wohnung. Durch ein schmales Fenster fiel Licht herein. Sie musste blinzeln. Zur Linken, in einem großen Bett, lag eine Frau. Die starrte mit fiebrigen Augen zu ihr. Zwei Mädchen, halbnackt, saßen am Fußende.
»Was will Ihre Dame?«, fragte der Mann.
Eleonore konnte nicht antworten, trat an das Bett und reichte der Kranken die Hand. Heiß und kalt zugleich. Sie riss sich zusammen, ließ die Hand los und drehte sich um.
»Meine Herrin möchte ein paar Sachen von ihnen geschneidert haben«, sagte sie.
Jablonski kratzte sich am Kopf. »Wie kommt Ihre Dame auf mich?«, fragte er.
»Eine Empfehlung«, antwortete sie. Mit zittrigen Fingern holte sie ihre Geldbörse hervor und entnahm ihr ein paar Geldstücke. »Wenn Sie bereit sind, soll ich Ihnen gleich einen Vorschuss geben«, führte sie ihre Lügengeschichte weiter.
Jablonski nahm zögernd das Geld.
»Sie dürfen das Geld ausgeben«, sagte Eleonore. »Ich werde morgen wiederkommen und ihnen die Arbeit bringen.«
Sie brachte ein verkrampftes Lächeln zustande, nickte der Frau und den Kindern zu und reichte dem Schneidermeister die Hand. Im Flur liefen ihr Tränen übers Gesicht. In ihrer Hand spürte sie noch die Hand der Frau. Nur eine flüchtige Berührung, doch ausreichend, um ihr zu zeigen, dass für die Kranke wenig Hoffnung bestand. Und sie konnte nichts dagegen unternehmen. Wie in Trance ging sie zum Ausgang. Ein weiteres Schicksal konnte sie heute nicht mehr ertragen.
Vor dem Haus saß immer noch der Junge. Vor sich auf seinem Schoß lag ein Stück Kartonpappe.
»Möchte die Gnädigste gezeichnet werden?«, fragte er, zu ihr aufblickend und den Kopf ganz in den Nacken gelegt.
Eleonore sah ihn ungläubig an.
»Womit willst du mich zeichnen?«, fragte sie.
Als Antwort zog der Junge ein Papier hervor und legte es auf die Pappe. Mit der anderen Hand hielt er ihr einen dunklen Keil entgegen. Erst bei genauerem Hinsehen erkannte Eleonore, dass es ein Stückchen Kohle war.
»Ick könnte dir ein Lächeln ins Gesicht malen.«
»Das bekomme ich selbst hin«, sagte sie. Mit den Handrücken wischte sie die Tränen von ihren Wangen. »Ich soll dir also Modell stehen?«, fragte sie. »Wieviel kostet das?«
»Was de entbehren kannst.«
»Na gut.« Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Hauswand.
Der Junge, er mochte zwölf oder dreizehn Jahre alt sein, musterte sie eingehend und machte dann die ersten Striche.
Eleonore dachte nach. Mit dem Schneider Jablonski hatte sie einen Anfang gemacht. Dem würde sie morgen eines ihrer Kleider vorbeibringen. Sie würde ihm einen Lohn zahlen, kein Almosen. Und er würde das Geld ausgeben. Das war ihr Plan, Geld in Umlauf zu bringen. Lass den Menschen ihren Stolz , so die Losung ihrer Mutter. Die Erinnerung an Mutter trieb ihr beinahe erneut Tränen in die Augen.
Читать дальше