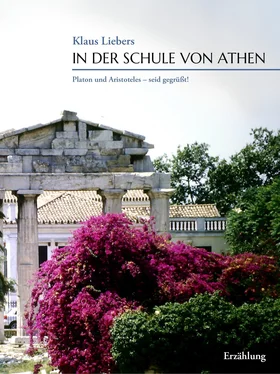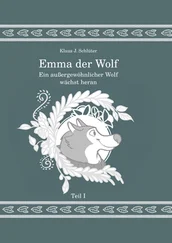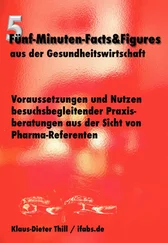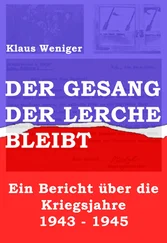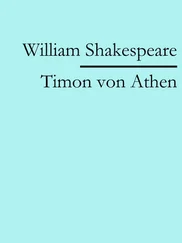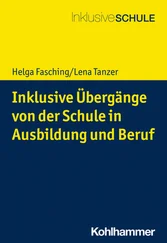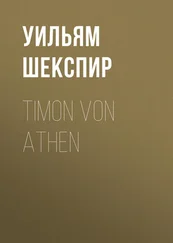Im Alter von zwanzig Jahren lernte er Sokrates kennen. Dessen Geistesrichtung zog ihn gewaltig an, ließ ihn nicht los, ergriff Platons Denken.
Ganz besonders beeindruckte den jungen Platon das Interesse von Sokrates für das Zusammenleben der Menschen. Wie soll ich leben? Auf welchen Fundamenten kann eine gerechte Staatsordnung entstehen? Welchen Platz nimmt der Einzelne in einem solchen Staat ein? Zu welchen Idealen soll die Jugend erzogen werden? Dies waren die Fragen, um die Sokrates rang, auf die er Antworten suchte. Sokrates schrieb keine einzige Zeile auf, nur dank Schriften zeitgenössischer Philosophen und Dichter wurde er seiner Nachwelt bekannt. Beliebte Zitate aus den Worten von Sokrates: „Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“ oder „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Auch dies sind Worte von Sokrates: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Zwischen Platon und Sokrates entwickelte sich ein vertrautes Schüler-Lehrer-Verhältnis. Rund ein Jahrzehnt blieb Platon bei Sokrates, bis zum Tod des geliebten Lehrers. Als Lehrer und Vorbild formte Sokrates das Fühlen, Denken und Handeln seines Schülers Platon.
Doch in welche Zeiten war Platon bloß hineingeboren? Diese wollten so gar nicht zu dem wohlbehüteten Dasein in der Familie und zu seiner Freundschaft mit Sokrates passen. Kindheit und Jugend erlebte er in einer 25-jährigen Folge von Kriegen zwischen Athen und Sparta, in deren Zwietracht nach und nach alle griechischen Stadtstaaten hineingezogen wurden. Diese Kämpfe erschütterten schließlich die gesamte griechische Staatenwelt. In die Geschichte gingen diese als der „Peloponnesische Krieg“ ein, er währte von 431 bis 404 v.Chr. Einige Historiker sprachen später vom „Dreißigjährigen Krieg der Antike“.
Der Krieg endete 404 v.Chr. mit dem Sieg Spartas und der totalen Katastrophe für Athen. Seit zwei Jahrhunderten hatten in Athen drei gewählte Einrichtungen über Gesetz und Recht zu entscheiden: die Volksversammlung, der Rat der Fünfhundert und die Volksgerichte. Unter Spartas Schutz stürzten Mitglieder aristokratischer Familien diese Verfassung und setzten an deren Stelle die Terrorherrschaft der 30 Tyrannen.
Kritias und Charmides – zwei enge Verwandte von Platon – agierten als die führenden Oligarchen. Sie luden den 23-jährigen Platon zur Teilnahme am politischen Leben ein. Ohne Umschweife lehnte er ab. Platon missbilligte dieses Regime, ja mehr noch, er verurteilte dieses System als verbrecherisch. Acht Monate währte der schändliche Spuk, dann ging die Schreckensherrschaft zu Ende. Doch schon begannen neue Kämpfe mit Ränkespielen, Intrigen und Morden: Auf der einen Seite rangen Aristokraten um die Wiedergewinnung längst verlorener Privilegien, auf der Gegenseite kämpften Anhänger republikanisch gesinnter Athener um den Wiederaufbau der Demokratie.
Die politischen Wirren ließen Platon an Athen verzagen. Zum Trauma entwickelte sich der Prozess, der im Jahre 399 v.Chr. gegen seinen Lehrer angezettelt wurde. Ein ums andere Mal fragte sich Platon: Warum nur diese Anklage gegen Sokrates? Feinde von Sokrates erhoben gegen Platons Lehrer den schwersten Vorwurf, den Athener Gesetze kennen: Mit seinem Philosophieren über Moral und einen gerechten Staat verderbe Sokrates die Jugend.
Die Verurteilung des geliebten Lehrers und der eigenhändige Vollzug des Todesurteils durch Sokrates gaben Platon den letzten Anstoß, an Athens Staatsform zu verzweifeln: Zum einen widersprachen die politischen Parteikämpfe seinem philosophischen Geist, zum anderen hasste er die allmählich wieder emporkommende Demokratie. Platon verachtete die Demokratie, weil nach seiner Meinung in der Demokratie eine unwissende und verantwortungslose Volksmenge beschließe, was ihr gerade passe. Platon, inzwischen 30-jährig, wählte freiwillig das Exil, verließ sein geliebtes Athen und begab sich auf eine Reise durch die griechisch sprechende Welt. Er hoffte, Anregungen für gerechtere Staatsformen zu finden. Ob er ahnte, dass seine Reise zwölf Jahre währen würde?
Wohin soll die Reise führen?
Viele Einzelheiten dieser Reise bleiben im Dunkeln. Als sicher gilt: Platon betrat 399 v.Chr. in Piräus die Planken eines Schiffes, das ihn zunächst nach Megara am Saronischen Golf brachte. Diese kleine Stadt auf halbem Wege zwischen Athen und Korinth hatte im Peloponnesischen Krieg schlimmste Verwüstungen hinnehmen müssen. Fünf Jahre vor Platons Ankunft hatten die Bewohner dieser Landschaft die drückende spartanische Fremdherrschaft abgeschüttelt. In ihrem Hass auf die Terrorherrschaft hatten sie alle Viehherden der Aristokraten getötet. Die Stadt erklärte sich zu der unabhängigen Polis Megara. Was könnte Platon als Aristokrat in diese Kleinstadt gelockt haben?
Sicher wollte Platon den Philosophen Euklid von Megara besuchen. Zum einen gab es für beide viel zu erzählen, vor allem über gemeinsame Erinnerungen an die Zeit, als sie noch Schüler von Sokrates gewesen waren. Zum anderen hatte Euklid in der Stadt am Golf eine eigene Philosophenschule gegründet und Platon wollte wissen: Zu welchen philosophischen Auffassungen war Euklid gelangt?
Wahrscheinlich beriet er sich mit Euklid auch noch einmal über seine Reisepläne. Sollte er nach Milet, Ephesos oder Knidos reisen? Schließlich hatten dort an der Küste von Kleinasien solch berühmte Naturphilosophen wie Thales, Anaximenes und Heraklit gewirkt. Doch hatte nicht Sokrates diese klugen Köpfe hart kritisiert?
Der Vorwurf von Sokrates lautete: Thales, Anaximenes, Heraklit und andere Naturphilosophen hätten allein nach der Beschaffenheit der Natur gefragt, es komme aber darauf an, über die Beschaffenheit des menschlichen Denkens und Handelns nachzudenken. Und konnte Platon in diesen Städten überhaupt Anregungen für eine gerechte Staatsform erhoffen? Mussten sich diese Städte doch ihr Wohlergehen mit Übereinkünften und Zugeständnissen an den persischen König erkaufen.
Letztlich entschied sich Platon in seinen Reisplänen für griechische Städte, die sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung gegenüber Athen nicht zu sehr abfielen. Aus dieser Sicht boten sich Syrakus auf Sizilien und Cyrene (im heutigen Libyen) an. Syrakus war die zweitgrößte griechische Stadt nach Athen. Cyrene war die größte unter den von griechischen Siedlern in Nordafrika gegründeten Städten. Auch Tarent erkor Platon als Reiseziel. Die Stadt galt als neues kulturelles Zentrum von Unteritalien.
Selbst Ägypten soll auf der Reiseliste des Weltenbummlers gestanden haben. Einzelheiten und Daten einer solchen Reise kann die Quellenlage jedoch nicht eindeutig ausweisen. Könnte es sein, dass der Aufenthalt in Ägypten einige Jahrhunderte später von Anhängern Platons nur erfunden worden ist? Einiges spricht für diese Annahme: Auf diese Weise hätten sie ihren wie einen Gott verehrten Philosophen mit den Traditionen der ägyptischen Wissenschaft in Verbindung bringen können und so Platons ohnehin schon großen Ruhm in der Nachwelt noch weiter gesteigert.
Als sicher gilt: Platon bestieg in Megara einen Frachtensegler, der ihn zunächst immer am Peloponnes entlangführte, vorbei an den Inseln Kythera, Antikythera und einigen weiteren kleineren Inseln, bis das Schiff schließlich Kreta erreichte – die Insel, wo einst Aphrodite aus dem Schaum der Meeresflut geboren und ans Licht gestiegen war. Kreta versperrte wie ein Querriegel den Weg an die nordafrikanische Küste.
Auf Kreta wechselte Platon das Schiff. Er suchte sich einen schnelleren Segler. Der Bootsmann hatte schon mehrmals die riskante Überfahrt zwischen Kreta und der afrikanischen Küste gemeistert – riskant, da zwischen Kreta und der nordafrikanischen Küste keine Insel mehr dem Schiff den Kurs wies und auch nachts gesegelt werden musste. Sicher verglich Platon seine lange Reise entlang der afrikanischen Küste nicht mit den Irrfahrten des Odysseus. Indes hoffte er bestimmt, dass die Bewohner von Cyrene ihn gastfreundlich aufnehmen würden, so wie die Einwohner dieses Küstenstriches einst den Helden Odysseus mit seinen Gefährten wohlwollend eingeladen hatten.
Читать дальше