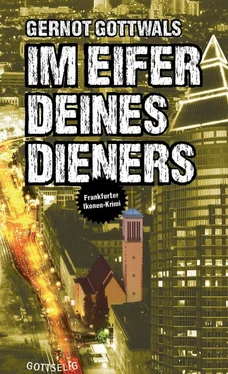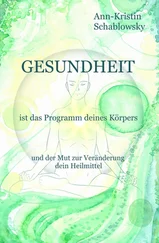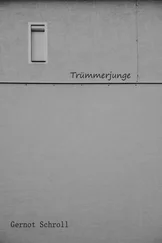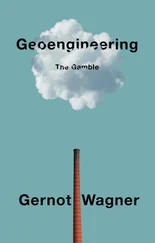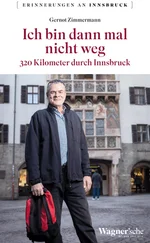Mit den Worten „Wenn Sie mir nun bitte folgen möchten“, bat der Direktor nun in den großen Ausstellungsraum im ersten Stock. Die ausgewählte Gruppe von zwanzig Journalisten und Ehrengästen folgte ihm willentlich, ließ sich an der schmiedeeisernen Brüstung durch den lichten Korridor mit Blick auf die bernsteinfarbenen Bleiglasfenster führen. Dazu der dumpfe, tiefe, aber doch melodische Stundenschlag des großen Glockenturms von Sergijew Possad – ja, jetzt stimmte die so mühsam einstudierte Choreographie endlich.
„Man, das sieht ja vielleicht barock aus!“ Die Journalistin Lisa Naumann konnte sich ihren vorlauten Kommentar einfach nicht verkneifen. Der Blick auf den mit üppigen Ranken geschmückten Torbogen offenbarte ihr das ganze Ausmaß preußischer Machtdemonstration – ihren Kollegen verschlug es vor Faszination die Sprache.
„Ja, da haben Sie durchaus Recht“, entgegnete Klotzhofer mit strahlenden Augen. „Das ist typisch Gründerzeit. Damals, als Frankfurt zu Preußen gehörte. Ein herrlicher und prachtvoller Stil, wie geschaffen für unsere Ikonenmalerei.“ Dabei wies der Direktor auf die Inschrift „Sitzungssaal“, die in verschlungenen Lettern unter dem neubarocken Sandsteingiebel des Eingangs zu lesen war.
„Dann mal hinein in die gute Stube!“ Mit großherziger Geste bat der Hausherr sein Gefolge in den weißen stuckverzierten Saal hinein. In der Mitte hatten die Raumdekoratoren die Kulisse einer imaginären Ikonostase aufbauen lassen. Links und rechts erzählten beschriftete biblische Szenen aus dem Leben Jesu, von Mariä Verkündigung bis zur Kreuzigung auf Golgatha. Dazu wurde die vielstimmige russisch-orthodoxe Liturgie des Heiligen Chrysostomos eingespielt – tiefe Bässe ergänzten sich mit engelsgleichen Frauenstimmen, die immer wieder die Macht des Herrn priesen:
„Gospodin, gospodin, gospodin, Amen.“
„Bitte hier entlang!“ Klotzhofer versammelte die Gruppe in der Mitte der Ikonostase vor einem schweren purpurnen Samtvorhang, der den Blick ins Allerheiligste verschloss. Wie ein Magier schob er den Vorhang beiseite. Dann kam endlich der Höhepunkt: die Ikone der Heiligen Barbara, die vor einem goldfunkelnden Hintergrund glänzte. Ein Abbild des Paradieses, das mit seinem lieblichen Lächeln und seiner funkelnden Krone aus der jenseitigen Welt herüberstrahlte. Das Meisterwerk eines unbekannten Künstlers, das jedoch in seinem kostbaren Kleid und der anmutigen sowie detailverliebten Ausführung für die unendlichen Weiten Sibiriens ein begehrtes Sammlerstück darstellte, zumal es viele Jahrzehnte lang als verschollen galt. „Schauen Sie sich nun das Kleinod unserer Sammlung an, die Heilige Barbara aus dem Oblast Jekaterinburg“, forderte Klotzhofer seine Besucher auf.
„Herr Direktor Klotzhofer, wenn Sie mir eine Frage gestatten“, meldete sich Lisa Naumann zu Wort, Journalistin beim Online-Journal „Art of Frankfurt“. „Ist es nicht doch etwas schwierig, solche Ikonen zu zeigen? Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber führende russische Geistliche fordern doch, solche Ikonen sollten besser Klöstern im Mutterland zur Verfügung gestellt werden, statt fern der Heimat für Aufsehen zu sorgen.“ Die hübsche Mittdreißigerin mit den rotblonden Haaren schrieb mit Ehrgeiz, wollte Kunst und Kommerz lebendig darstellen – all die Geschichten, die hinter dem Boom von Ausstellungen und ambitionierten Ausstellungsmachern steckten.
Doch Klotzhofer wiegelte sofort ab: „Für jedes der Exponate haben wir das Gutachten eines renommierten Kunsthistorikers. Ebenso für die Heilige Barbara. Hier sind wir sogar in der glücklichen Lage, das Kloster zu kennen und die Herkunft rekonstruieren zu können. Da ist nichts Schwieriges oder gar Problematisches dabei. Im Gegenteil: Diese Ikonen wurden vor ihrer Vernichtung gerettet und finden seitdem in Russland keinen Eigentümer mehr, der sie aufarbeiten und in einer der ursprünglichen Kirchen oder Klöster ausstellen könnte. Wissen Sie überhaupt, wie die Orthodoxe Kirche in den osteuropäischen Ländern aufgestellt ist? Da ist nichts mit Kirchensteuern oder sonstigen nennenswerten Zuwendungen, um all die Gotteshäuser mit ihren Ikonen in diesem riesigen Land zu unterhalten.“
Ein Kollege von Lisa Naumann warf dem Direktor einen irritierten Blick zu, als könnte er dessen Ausführungen nicht recht folgen. Doch der ließ sich davon nicht irritieren: „Nun schauen Sie doch bitte noch einmal selbst, wie sorgfältig und liebevoll zugleich der namenlose Künstler hier gearbeitet hat. Man erkennt sofort, wie sehr er von der alten Schule beeinflusst wurde, die auch die Barbara-Ikone in Tver aus dem 15. Jahrhundert gemalt hat.“
„Aber müssten die Gesichtszüge der Heiligen dann nicht um einiges strenger ausfallen?“, hakte Lisa Naumann nach. „Das Gesicht der Barbara mutet so sanft und lieblich an, wie man es von einer orthodoxen Ikone eigentlich gar nicht kennt.“
„Eben nicht“, konterte Klotzhofer und setzte nun wieder seine triumphierende Miene auf. „Wir sind nämlich nicht im nordwestlichen Russland des 15. Jahrhunderts, sondern im westlichen Sibirien des 17. Jahrhunderts. Natürlich hat die alte Schule noch nachgewirkt und die wichtigen Vorlagen für die traditionelle und detailgetreue Ikonenkunst geliefert. Und doch konnte der namenlose Künstler seinen eigenen Stil und seine ganz eigene Ausdrucksweise entwickeln. Deshalb begegnet uns die Heilige in dieser Ikone mit einem sehr weichen und anmutigen Gesicht. Und die Farben des Gewandes leuchten etwas voller und kräftiger. Und wenn Sie mir nun in den Nebenraum folgen wollen. Dort können Sie noch einen Film sehen, der Ihnen die Geschichte der Ikone und die Ereignisse im Kloster des Propheten Elias erzählt.“
Klotzhofer führte die Gruppe in den Nebenraum, wo der Techniker bereits die CD eingelegt hatte. Der feurige Abendhimmel in den Weiten Sibiriens und die Kuppelchen des Holzklosters entfalteten gerade ihren vollen Zauber, als plötzlich der Bildschirm flimmerte und der Techniker eine Störung des Gerätes vermelden musste. Klotzhofer hätte am liebsten laut geflucht. Verdammte Technik! Doch jetzt hieß es Contenance bewahren. „Nun, den Film können Sie sich ja später noch ansehen“, versicherte er mit einem aufgesetzten Lächeln. „Dann gehen wir doch so lange runter ins Foyer und trinken noch ein Schlückchen.“
Ja, es war seine eigene Sammlung, die Werner Klotzhofer in seinem herausgeputzten Kunst- und Musentempel der Öffentlichkeit präsentierte. Der untersetzte Glatzkopf mit der erhabenen Miene, die in gewissen Situationen in ein Pokerface wechseln konnte, hatte alles auf eine Karte gesetzt – und es schließlich bis weit in die oberste Liga gebracht. Mit den wohlbekannten Jokern, ein wenig Wagemut und der Hilfe eines Freundes hatte der ambitionierte Glücksritter in dem millionenschweren Fernsehquiz die Höchstfrage geknackt und den Geldsegen in einem Feuerwerk der Emotionen geerntet. Doch danach würde später niemand mehr fragen. Klotzhofer hoffte, das alte Polizeipräsidium dauerhaft als Museum anmieten und schließlich kaufen zu können. Und zwar spätestens dann, wenn die Investoren für neue Wolkenkratzer endgültig durch Wirtschaftskrisen und den zunehmend gesättigten Immobilienmarkt in die Knie gezwungen würden. Deshalb brauchte Klotzhofer nur ruhig abzuwarten.
Zunächst ertönten die obligatorischen Grußworte der wichtigsten Referenten aus dem Frankfurter Magistrat und dem Hessischen Kultusministerium. „Lieber Herr Klotzhofer, dank Ihres Engagements zieht die Frankfurter Museumslandschaft bald mit Berlin gleich.“ Mit dieser kurzen Ermutigung gab sich der Kulturdezernent die Ehre, bevor er sich frühzeitig zum Empfang im Sachsenhäuser Ikonenmuseum verabschiedete. Die restlichen Promis ließen sich mit ergebenem Blick von Friedrich durch die Räume führen und die großartigen Ikonen erklären. Sie alle gaben wie eingeübt ihre versichernden Erklärungen ab: Dieses Museum mit seinen Heiligenbildern wäre eine ausgesprochene Bereicherung für Frankfurt. Dann lächelten sie professionell, betonten noch einmal den ausgesprochen hohen kunstgeschichtlichen Wert der Exponate, bevor sie sich für einen Moment entschuldigten und dem Büffet zuwandten. Kaviar und Krimsekt schienen sie weitaus mehr zu faszinieren.
Читать дальше