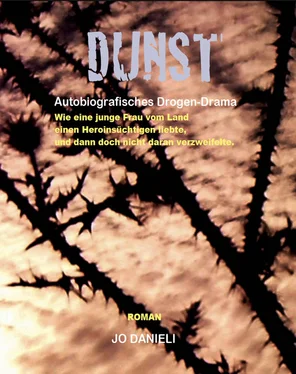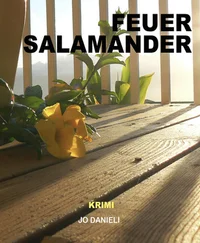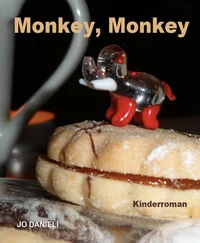Es hat mir die Sprache verschlagen vor Hilflosigkeit gegenüber diesem gnadenlosen Abschmettern meines Wunsches nach Verstehen. Ich weiß schon, wenn die Leute einen fragen »Wie geht es dir?« hoffen sie, man möge »Gut« sagen und sofort das Thema wechseln. Steuert man auf die Wahrheit los, haben sie es plötzlich eilig, aufzulegen, zu gehen, oder sie überschwemmen einen mit gedankenlosen »Ja«s und »Ach so«s und »Wird schon«s und fangen an über sich zu reden, sobald man Luft holt. Es beleidigt schmerzhaft, die eigene Chancenlosigkeit unter die Nase gerieben zu bekommen.
Mag sein, ich bin nicht mehr die alte. Aber ich habe dennoch Pläne. Wenn ich beim Tanzen nicht mehr hoffen werde, grell zuckendes Licht möge mein Gesicht nicht völlig enthüllen und wenn nicht mehr versuchen werden, stets in den Schatten auszuweichen, werde ich mich auch wieder mit Leuten verabreden und einer geregelten Arbeit nachgehen. Ja, irgendwann werde ich mein Gesicht wieder in das Licht halten. Wenn jemand mit mir zu flirten versucht, egal, ob Mann oder Frau, erschrecke ich, denn ich argwöhne, er oder sie tue es nur, weil er oder sie glaubt, jemand wie ich müsse ein leichter Fall sein. Oder ich argwöhne, man findet mich hart und hässlich.
Du spinnst ja, pflegt ein »Freund« dazu zu sagen. Warum sagt er mir nicht, wie man es macht, dass man nicht mehr spinnt?
»He,« sage ich mir manchmal selber, »... du bist ganz schön kaputt, Mädchen.« Dann lege ich vielleicht die Red Hot Chili Peppers in den Kassettenrecorder, suche mir »Give it away« heraus und tobe. Oder ich mache so etwas wie Aerobic zu »Primal Chaos« aus einer Technosammlung. Mein Hund hüpft aufgeregt um mich herum, weil ich so wild die Fäuste und meinen Kopf schwinge und mich drehe wie verrückt, und außerdem lache ich dabei. Wenn ich konsequent genug bin, neben dem Toben auch ein bisschen daran zu denken, meine Muskeln zu spannen und sinnvoll in die Knie zu gehen und es auch tue, fühle ich mich nachher ganz gut.
Niemand sonst, außer mir selber, wagt mir zu sagen, ich sei weich in der Birne, weil er sonst mit mir darüber reden müsste. Es ist bequemer zu sagen »Wird schon wieder« als »Erzähl' mir.« Nur meine Hund sieht mich ganz seltsam an, wenn ich schlecht drauf bin und diese Stimmung an ihm auslasse. Hunde können sich nicht verstellen.
Ich bin zur exzessiven Tänzerin in Untergrundschuppen geworden, wo Techno gespielt wird und Jungle und House und Psychedelic Trance. Diese Musik und das Insiehineinfallenlassen sind nun überlebenswichtig für mich. Und in einschlägigen Clubs und auf Raves treffe ich immer wieder dieselben Leute, die mir anscheinend ähneln: Sie tanzen - und wie sie tanzen! Stundenlang. Nächtelang. Zusammen und doch einsam. Neulich habe ich nach einer derartigen erschöpfenden Nacht kichernd vor Überschwang ein Gedicht geschrieben. Es ist einem jungen Mann gewidmet, den ich oft beim Tanzen treffe und den ich weiter nicht kenne. Es heißt »Teufelchen«, hier ein Auszug:
Was muss ich grinsen, schon zu Beginn,
da ich noch gar nicht beim Dichten bin.
»Teufelchen« zu dir zu sagen
ist, als würd' ich frechlings wagen
dich an eine Wand zu malen
um still beglückt dich anzustrahlen.
(...)
Streif' ich durch die Stadt und suche Vergessen,
ist simples Vergnügen mir spärlich bemessen.
Darum bin ich froh über all jene Stunden
die mir einen Tag gar erlebenswert runden.
Nach vielzuviel Mühe vergangener Zeit
bin ich doch gar nicht zum Feiern bereit.
Doch wenn es geschieht, dass Nettes mich streift,
dass fremdes Bestehen mein Sinnen ergreift
statt altes Erinnern, dann fühl' ich verwirrt,
dass neben Vergang'nem noch viel existiert
das schön ist und wichtig und liebenswert gut.
Ich lerne: auch stilles Betrachten macht Mut. (Und so weiter.)
Es ist furchtbar kitschig geraten. Aber es ist auch köstlich ehrlich und vollgestopft mit Laune und Ehrlichkeit. Teufelchen wird es eines Tages von mir zum Lesen bekommen. Warum auch nicht? In einer Welt der Kriege muss es ein leichtes sein, Wildfremden Gedichte zu schenken.
*
Eigentlich ist an mir nichts, was es nicht auch im Lebenslauf anderer Zweiunddreißigjähriger geben könnte oder was eben auch darin fehlt. Ich nehme keine Drogen, obwohl ich ein geradezu erotisches Verhältnis zu ihnen habe. Die Tatsache, dass ich nur zugreifen müsste, um mich ihnen hinzugeben, reizt mich auf. Weder bin ich magersüchtig, noch saufe ich. Ich hasse es, wenn Leute Kühlschränke und Möbelgarnituren einfach in den Wald »entsorgen«, wobei das Zeug natürlich Jahrhunderte lang nicht verrottet. Die Augen tun mir weh von den aufgedonnerten Peinlichkeiten auf Plakatwänden, denen man nicht mehr entrinnen kann. Politiker respektiere ich nicht und winde mich hilflos unter den unsinnigen Regeln, die sie, weltfremd und präpotenzgeschwellt, aufstellen. Die Schlagzeilen in den populären Schmiermedien bringen mich fast zum Kotzen, und ich mag nicht mehr zuhören, was die Leute in den Straßenbahnen reden. Weder bin ich fernsehsüchtig, obwohl ich manchmal unterhalten werden will, noch teile ich blindlings professionelle Meinungen über angeblich großartig Zeitgenössisches oder Vergangenes ...
Man sieht - alles ist irgendwie in Ordnung mit mir. Nur etwas unterscheidet mich eindeutig von meinen Bekannten: Sobald es um Drogen geht, muss ich mich ausklinken, ganz abgesehen davon, dass ich die klischeehaften Ansichten darüber satt habe. Gerade ich könnte doch aufheulen »Um Gottes Willen! «. Statt dessen sage ich »Jeder wie er will ...« Meine Erfahrungen heraufbeschwören, nur weil gewisse Leute reichlich spät und weil es ihnen gerade ins Plauderkonzept passt, daraufkommen, dass ich welche habe, mag ich nicht mehr. Keine Ratschläge sind von mir zu bekommen, nichts Hilfreiches. Bekannte konsumieren Antidrogenfilme, jammern »... ah, wie furchtbar« und schmausen Popcorn, oder sie schütteln den Kopf über die Zustände in der »Szene«, weil - laut gieriger Berichterstattung - wieder ein strafunmündiger türkischer Dealer selber drauf war und in einem U-Bahn-Klo abgekratzt ist.
Auf keinen Fall will ich noch wissen, welche superschlauen Theorien zu Sucht und Entzug sich selbsternannte Fachleute aus den Fingern gesogen haben, Leute, die noch keinen Tag in ihrem Leben entweder süchtig oder einem Süchtigen angehörig gewesen sind. Ich will keine suppendünnen Stories von inkompetenten Zeitgeistjournalisten über Teilzeitjunkies lesen. Es ist nicht toll, wie die Prominenz auf Koks herumzurennen, auch für die Prominenz nicht immer, aber das kommt aus den Geschichten nicht heraus. Und wenn »begnadete« junge Autoren Drogenromane »knallhart« aus der »Szene« schreiben, mit potentiellen, aber feigen Giftlern unter uns Kohle und Berühmtheit gegen seismischen Kitzel im Organ Gefangene Verderbte Lust tauschen, möchte ich zuschlagen. Egal, was ich treffe. Schon gar nicht möchte ich erleben, wie kommerzsüchtige Regisseure das Thema mit viel Musik, tollen Beleuchtungseffekten und superattraktiven Darstellern vor dem ahnungslos lechzenden Publikum breittreten. In Wirklichkeit kotzt der Fixer auf Entzug nicht unter geilen Rhythmen, schaut er nicht zum Anbeißen an, auch wenn er im Arsch ist, sind verluderte Dealerbuden nicht hübsch belebt von Licht-Schatten-Effekten und reiht kein Techniker die Szenen aus dem Leben eines Süchtigen leicht verdaulich aneinander. Die wahre Drogenszene besteht aus Kälte, schleppender Sprache, Angst, verfallenden Körpern, Eile, Missachtung, dem Gestank von Erbrochenem, schlechtem Gewissen, Schmerz, Dämmerung, Hunger, Alleinsein, Schläfrigkeit und dem Gefühl, auf abschüssigem Glatteis ins Schlittern zu kommen oder bis zum Hals in zäher Marshmallow-Paste zu waten.
Tja, wie heißt es in irgendeinem Gedicht? Der Mond ist auch oft nur halb zu sehen und ist doch rund und scheußlich kahl ... oder so ähnlich.
Читать дальше