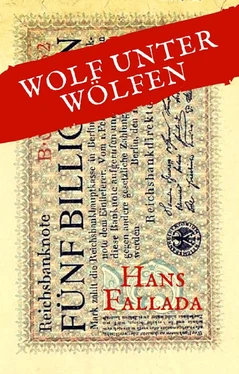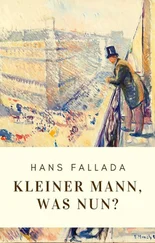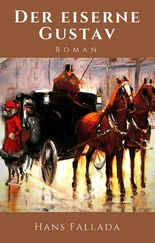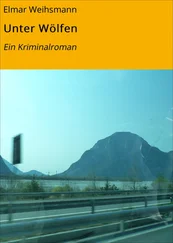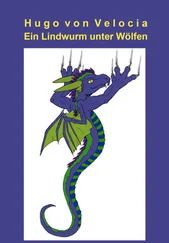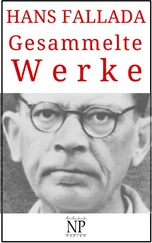Schon damals war die letzte Waffe der Hühnerweihe ein heulendes Gekreisch gewesen, ein hysterisches Wutgeschrei, ins Unfaßliche gesteigert durch Kokain und Alkohol – jeder Kavalier suchte das Weite, wenn sie damit anfing.
Petra hatte immer das Gefühl gehabt, daß sie der Hühnerweihe ganz besonders mißfällig war und von ihr mit einem noch gesteigerten Haß verfolgt wurde. Einmal war sie einem tätlichen Angriff nur durch eine panikartige Flucht durch die nächtlichen Straßen bis hinunter zum Viktoria-Luise-Platz entgangen, wo sie schließlich hinter dem Säulenhalbrund ein Versteck fand. Ein anderes Mal aber war sie nicht so glücklich gewesen: Die Hühnerweihe hatte sie aus einer Autotaxe, in die sie mit einem Herrn gestiegen war, wieder herausgeholt, und es hatte einen Kampf zwischen den beiden gegeben (der Herr war im Auto entflohen), bei dem Petra ein Kleid zerrissen und ein Schirm zerbrochen worden war.
Das alles war sehr lange her, fast ein Jahr – oder schon mehr als ein Jahr? –, unendlich viel hatte Petra danach erfahren. Das Tor einer andern Welt hatte sich seitdem für sie geöffnet, und doch sah sie mit der alten Angst auf die Feindin von damals. Die hatte sich auch verändert seitdem, doch zum Schlimmeren. Sagte schon die Verlegung des Jagdreviers aus dem reichen Westen in den armen Osten genug von den nachlassenden Reizen der Hühnerweihe, in der Hauptsache hatten doch wohl die Rauschgifte – Kokain und Alkohol – in dem jungen Wesen ihr Werk getan. Die damals noch sanfte, runde Wange war hager und faltig geworden, der weiche, rote Mund rissig und trocken, jede Bewegung fahrig, wie irr.
Sie schrie, sie verspritzte allen Geifer, sie keifte atemlos – dann fragte der gelbliche Sekretär etwas, und sie fuhr wiederum los, als erneuere sich, geheimnisvoll, der Schmutz ständig in ihr. Schließlich machte der Sekretär eine Bewegung zu den beiden Polizisten, diese drehten das Mädchen von dem Verhandlungstisch fort zu den Zellen, und der eine sagte ruhig: „Na, denn komm, Kleines, schlaf deinen Rausch aus.““
Sie setzte grade an, wieder loszuschimpfen, als ihr Blick durch die Gitterstäbe auf Petra fiel. Mit einem Ruck blieb sie stehen und schrie triumphierend: „Habt ihr das Aas endlich?! Gott sei Dank, diese verdammte Hure – ist sie schon unter Kontrolle?! So ein Schwein – nimmt einem anständigen Mädchen alle Kavaliere weg und macht sie noch krank, diese Nutte, diese elende! Die geht auf den Strich, Herr Wachtmeister, noch und noch – und alle Krankheiten hat sie im Leibe, so eine Drecksau, wie die –!““
„Komm, komm, Mädchen““, sagte der Polizist ruhig und löste ihre Hand Finger um Finger von den Gitterstäben vor Petras Zelle, die sie umklammert hielt. „Schlaf dich ein bißchen aus!““
Der Sekretär war hinter seinem Tisch aufgestanden und näher getreten. „Bringt sie lieber nach hinten““, sagte er. „Sonst versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Koks – wenn der erst verflogen ist, fällt sie zusammen wie ein nasser Waschlappen.““
Die Polizisten nickten, zwischen ihren festen Gestalten flatterte das Mädchen, nur noch aufrecht gehalten von unsinniger Wut, die sich an allem entzündete. Noch über die Schulter, dann schon unsichtbar geworden, schrie sie Beschimpfungen gegen Petra.
Der Sekretär wandte langsam seinen dunklen, müden und kranken Blick (auch das Weiße seiner Augen war gallengelb) auf Petra und fragte halblaut: „Stimmt das, was die sagt? Sind Sie auf den Strich gegangen?““
Petra nickte, kurz entschlossen. „Ja. Früher, vor einem Jahr. Jetzt schon lange nicht mehr.““
Auch der Sekretär nickte, sehr gleichgültig. Er ging wieder zu seinem Tisch. Blieb aber noch einmal stehen, wandte sich und fragte: „Sind Sie wirklich krank?““
Petra schüttelte energisch den Kopf. „Nein. Nie gewesen.““
Wieder nickte der Sekretär, ging vollends an den Tisch und machte sich an seine unterbrochene Schreiberei.
Das Leben in der Wachtstube lief weiter, vielleicht waren manche der Festgenommenen in Angst, in Unruhe und Sorge, vielleicht quälten Träume die Trunkenen – äußerlich war alles glatt, ruhig, teilnahmslos.
Bis kurz nach sechs die telefonische Meldung eintraf, der Oberwachtmeister Leo Gubalke liege hoffnungslos mit Bauchschuß. Er werde wohl noch vor Mitternacht sterben. Von da an änderte sich das Gesicht des Reviers vollkommen. Ständig klappten die Türen, immer kamen und gingen Beamte in Zivil, in Uniform. Flüsterten miteinander; ein dritter trat dazu, einer fluchte. Um halb sieben kamen dann die Kameraden Gubalkes, in deren Kampf mit den beiden Ringvereinen er grade hatte eingreifen wollen, als ihn die Mörderkugel traf. (Der einzige Schuß, der überhaupt gefallen war.) Das Flüstern, das Tuscheln verstärkte sich. Es wurde auf den Tisch geschlagen; ein Polizist stand finster in einer Ecke und wippte ununterbrochen mit seinem Gummiknüttel; die Blicke, die die Gefangenen streiften, waren nicht mehr gleichgültig, sie waren finster.
Ganz besonders nachdrücklich aber waren die Blicke, die auf Petra Ledig haftenblieben. Jedem erzählte der Sekretär, daß dies „die letzte Amtshandlung von Leo““ war. Weil er dieses Mädchen festgenommen hatte, war Gubalke zwanzig Minuten zu spät gekommen. Wäre er pünktlich gewesen, geschlossen mit den andern ausgerückt, hätte ihn die Mörderkugel vielleicht nicht – nein, bestimmt nicht! – getroffen!
Der schwer und qualvoll Sterbende dachte jetzt vielleicht an seine Frau und an die Kinder. Und vielleicht freute es ihn in der Hölle seiner Schmerzen, daß sich wenigstens seine Mädchen so wuschen wie er. Er hinterließ eine Spur seines Wesens auf dieser Welt, ein kleines Zeichen dessen, was er für Ordnung gehalten hatte. Oder er dachte, von der Todesahnung überschattet, daran, daß er nun nie in seinem Leben auf einem sauberen Büro sitzen und ordentliche Listen führen würde. Oder an seinen Laubengarten. Oder daran, ob die von der Sterbe- und Begräbniskasse bei der jetzigen Geldentwertung so viel zahlen würden, daß es zu einem anständigen Begräbnis reichte. An vielerlei konnte der Sterbende denken – aber die Wahrscheinlichkeit, daß er an seine „letzte Amtshandlung““ Petra Ledig dachte, war sehr gering.
Und doch bemächtigte sich der Sterbende dieses Falles, er sonderte ihn von allen andern. Die Augen der Kollegen sahen nicht mehr ein belangloses junges Mädchen dort auf der Bank sitzen – nicht umsonst konnte sich der Sterbende ihretwegen zwanzig Minuten verspätet haben! Die letzte Amtshandlung Gubalkes mußte wichtig gewesen sein.
Der schwere, große, traurig aussehende Reviervorsteher mit dem grauen Wachtmeisterschnurrbart kam in den Raum, stellte sich neben den Tisch des Sekretärs und fragte, mit den Augen deutend: „Das ist sie –?““
„Das ist sie!““ bestätigte der Sekretär halblaut.
„Er hat mir nur gesagt, daß sie mit Spielern zu tun hat. Weiter nichts.““
„Ich habe sie noch nicht vernommen““, flüsterte der Sekretär. „Ich wollte warten, bis – er wiederkäme.““
„Vernehmen Sie sie““, sagte der Reviervorsteher.
„Die Betrunkene vorhin, die solchen Krach gemacht hat, hat sie erkannt. Sie ist auf den Strich gegangen, hat es mir auch zugegeben, behauptet allerdings, nicht mehr in letzter Zeit.““
„Ja, er hatte einen scharfen Blick. Er sah alles, was nicht ganz in Ordnung war. Er wird mir sehr fehlen.““
„Uns allen. Mächtig fleißig und ein guter Kamerad, gar kein Streber.““
„Ja – uns allen. – Vernehmen Sie sie. Denken Sie daran, daß das einzige, was er gesagt hat, etwas von Spielern war.““
„Daran denke ich schon. Wie kann ich das vergessen?! Ich werde sie fest in die Zange nehmen.““
Petra wurde an den Tisch geführt. Hätte sie nicht schon aus den häufigen Blicken, aus dem Stehenbleiben an ihrer Zelle gemerkt, daß etwas im Gange war – die Art, wie der gelbliche Sekretär nun mit ihr sprach, mußte ihr verraten, daß die Stimmung sich verändert hatte, und zu ihren Ungunsten. Etwas mußte geschehen sein, das die Leute übel von ihr denken ließ – konnte es mit Wolf zusammenhängen? Diese Unsicherheit machte sie ängstlich und befangen. Ein- oder zweimal berief sie sich auf den freundlichen Wachtmeister, „der in unserm Hause wohnt““, aber das finstere Schweigen, das Reviervorsteher wie Sekretär auf diesen Appell hatten, erschreckte sie noch mehr.
Читать дальше