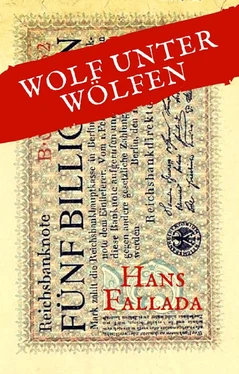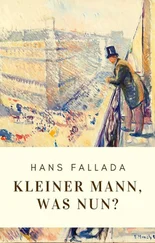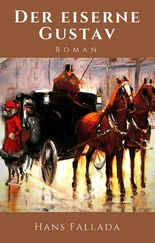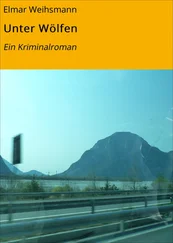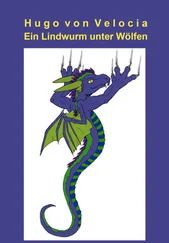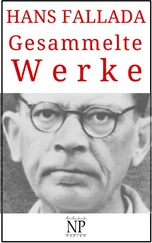Es war ihnen gleichgültig, wozu dieser Mann im schäbigen Waffenrock so eilig das Geld brauchte, daß sie auf ihre Abendvergnügungen verzichten mußten; es war ihnen nicht gleichgültig, ob ein Bild, das der Chef zu kaufen wünschte, wieder aus dem Hause getragen wurde. Das Hergeben, Aufzählen, Notieren des Geldes geschah auf beiden Seiten so selbstverständlich – auch von seiten des Kaufmanns ohne jeden beflissenen Dank, ohne billigen Scherz, ohne verlegene Erklärung –, daß grade diese Selbstverständlichkeit Pagel beinahe dazu veranlaßte, erklärend, entschuldigend zu sagen: Ich brauche das Geld wirklich heute abend noch. Mein Mädchen ist nämlich im Gefängnis, und ich muß …
Ja, was mußte er eigentlich –? Jedenfalls sofort Geld haben, viel Geld.
Wolfgang Pagel sagte nichts.
„Halt, Fräulein Bierla““, sagte der Händler. „Ich sehe da noch fünfzigtausend in Ihrem Portemonnaie – Sie entschuldigen, aber wir müssen heute abend jede Mark zusammenkratzen …““
Verlegen murmelte die bräunliche Schöne etwas von Fahrgeld.
„Sie brauchen natürlich kein Fahrgeld. Doktor Mainz hat zu Geschäftsschluß ein paar Taxen vor die Tür bestellt. Die Chauffeure fahren Sie, wohin Sie wollen.““
Langsam wuchs der Stoß Papierscheine auf dem Schreibtisch. Unzufrieden sagte der Händler, in der eigenen Brieftasche kramend, sie entleerend, zu Doktor Mainz: „Wenn man die Zeitungen liest, auf die Leute hört, schwimmt alles im Geld. In allen Taschen sitzt es, in allen Händen raschelt es. Hier liegt das, was siebenundzwanzig Menschen, Sie und ich eingeschlossen, bei sich trugen. Es sind noch keine siebenhundert Mark, nach Friedenssatz. Eine lächerlich aufgebauschte Angelegenheit, diese Zeit. Wenn die Leute sich einmal klarmachten, wie wenig Ziffern vor so vielen Nullen stehen, würden sie sich nicht so bezaubern lassen.““
Doktor Mainz flüsterte etwas Halblautes, Hastiges.
„Nun natürlich, telefonieren Sie gleich von hier aus. Ich gehe unterdes zu meiner Frau. Dort finde ich sicher Geld.““
Während Doktor Mainz mit irgendeinem Herrn Direktor Nolte telefonierte, der eigentlich heute abend noch zweihundertfünfzig Papierdollar bekommen, nun aber bis morgen früh sich gedulden sollte, bedachte Pagel, welch ungewohnte Unordnung sein Verlangen in diesen Betrieb getragen hatte. Aber – stellte er verwundert fest – wie ordentlich wickelte sich selbst solche Unordnung ab! Leise, selbstverständlich – Autos warteten vor der Tür, jeder Angestellte kommt trotzdem dahin, wohin er zu kommen wünscht; auf einem Zettel stehen säuberlich die Einzelbeträge … Während die Unordnung entsteht, geschieht schon alles, um sie nach möglichst kurzer Spanne wieder zu beseitigen.
Ich, denkt Pagel düster, habe auch Unordnung entstehen lassen, aber nie habe ich daran gedacht, sie zu beseitigen. Sie ist größer und größer geworden, sie hat Bezirke ergriffen, an die ich nie gedacht hatte. Jetzt ist alles bei mir Unordnung, es gibt nichts Geordnetes mehr bei mir!
Einen Augenblick denkt er daran, daß er oft von Petra verlangte, sie sollte sich morgens anziehen, ehe die Thumann den Kaffee brachte.
Ich habe mir und vor allem ihr etwas vorgespielt. Unordnung wird nicht zur Ordnung, wenn man eine Decke darüberlegt. Im Gegenteil: sie wird zur Unordnung, die man nicht mehr zu vertreten wagt. Zu einer verlogenen, feigen Unordnung. Ob Peter wohl etwas davon verstanden hat –? Was sie nur gedacht hat –? Hat ihr darum so viel daran gelegen, daß wir einander heirateten –? War es auch bei ihr der Wunsch nach Ordnung? Immer hat sie ohne ein Wort getan, was ich vorschlug. Im Grunde weiß ich nichts von dem, was sie gedacht hat …
Der Händler kommt lachend, ein dickes Bündel Papiergeld schwingend, zurück.
„Heute abend bleibt bei mir alles zu Haus. Meine Frau ist selig, sie wollte zu irgendeiner grausigen Premiere, mit nachfolgender Feier des schon jetzt zu einem Ochsenfrosch aufgequollenen Dichters. Sie ist froh, daß wir nun nicht hin können. Sie telefoniert schon begeistert aller Welt, daß wir gänzlich ohne einen Pfennig sind – morgen werde ich meine Zahlungseinstellung in der Zeitung lesen. – Und Sie, Doktor?““
Es erwies sich, daß auch Doktor Mainz erfolgreich gewesen war: Herr Direktor Nolte wollte auf seine zweihundertfünfzig Dollar bis morgen früh warten.
„Bitte, Herr Pagel““, sagte der Händler. „Tausend Dollar – siebenhundertsechzig Millionen. Es hat allerdings““, er zog die Uhr, „achtunddreißig Minuten gedauert; ich bitte für die acht Minuten um Entschuldigung.““
Warum verhöhnt er mich eigentlich? dachte Pagel erbittert. Er sollte mich lieber fragen, wozu ich das Geld brauche! Man kann doch in eine Lage kommen, in der man sofort Geld braucht! Eine Stimme in ihm sprach, daß man sehr wohl in solche Lage kommen könne, daß es da aber noch so etwas wie eine Schuldfrage gebe … Kann ich für die Dämlichkeiten der Polente –?! erbitterte er sich …
„Es ist etwas viel Papier, dem Zuge der Zeit entsprechend““, lächelte der Kunsthändler. „Soll ich Ihnen ein Paket daraus schnüren lassen? Sie stecken es lieber in die Taschen? Es regnet sehr stark draußen. Nun, Sie nehmen wohl ein Auto … Gleich rechts, wenn Sie aus unserer Tür kommen, vor dem Hotel Esplanade … Oder soll ich Ihnen eines rufen lassen?““
„Nein, danke““, hatte Pagel mürrisch gesagt, indem er das Papier in seine Taschen zwängte. „Ich gehe …““
Und nun ging er schon durch die Königstraße, ziemlich durchnäßt, die Hände schützend über die beiden Außentaschen gebreitet. Sie mochten mit ihm böse werden wie die Mutter oder höhnisch wie dieser Bilderfritze, sie mochten auch in Bedrängnis geraten wie der Peter – er tat genau das, was er wollte, mit dem Kopfe durch die Wand. Er riß das Geld nicht an, er dachte nicht daran, sich ein Auto zu nehmen, und wenn seine Taschen von Geld platzten –! Wollte er nicht, zwangen ihn weder Regen noch Not.
Er ging auch jetzt nicht etwa direkt auf die Polizeiwache, wo die Petra saß; er ging erst einmal zu der Thumannschen – auf Erkundung. Nach wie vor war er überzeugt, daß alles im Leben Zeit hatte. Er war ein Maulesel: je mehr man ihn schlug, um so störrischer wurde er.
Oder aber – hatte er vielleicht einfach Angst vor dem, was er auf der Wache erfahren würde? Fürchtete er sich vor der Scham, die er empfinden mußte, wenn er Petra in dieser kläglichen Lage wiedersah?
Pfeifend überquert er den Alexanderplatz und biegt in die Landsberger Straße ein. Er denkt intensiv darüber nach, was Petra mehr Freude machen würde: ein Zigarrenladen oder ein Blumengeschäft? Oder noch lieber eine Eisdiele –?
Der Polizeioberwachtmeister Leo Gubalke war bestimmt kein Mann, der – dienstlich oder außerdienstlich – zu Übergriffen, kleinen Gehässigkeiten, Schikanen neigte. Jene gefährlichste Versuchung für jeden Mann, in dessen Mund das Wort der Macht gelegt ist: „Gehorch oder krepier!““ – sie versuchte ihn nie. Wenn ihm zu Haus oder im Dienste doch ab und an jene kleinen Gemeinheiten unterliefen, die dem Selbstgefühl keines Menschen erspart bleiben, so war es immer sein übertriebener Sinn für Ordnung und Pünktlichkeit, der ihn verführte.
Dieser Sinn hatte ihn das Mädchen Petra Ledig aus dem Torgang in der Georgenkirchstraße mitnehmen lassen, und dieser gleiche Sinn war es auch, der ihn auf die vorwurfsvolle Frage seines Reviervorstehers: „Aber, Gubalke, Mensch, ausgerechnet Sie gehen zwanzig Minuten nach?!““ stramm melden ließ: „Habe eine Festnahme gehabt. Mädchen – hat mit Spielern zu tun.““
Dieser Nachsatz, den er ohne Verspätung nie gesagt hätte – denn nichts lag ihm ferner, als der Petra Ledig Übles zu tun –, war für einige Stunden vorläufig das einzige, was die Wache über diese Festnahme erfuhr. Oberwachtmeister Gubalke hatte nur das halbnackte Mädchen von der Straße bekommen wollen. Er hatte vorgehabt, sie auf eine Bank in der Wache zu setzen, ihr etwas zu essen zu verschaffen. Dann hätte man im Laufe des Abends gesehen, was eigentlich an diesem Mädchen dran war, hätte irgendeinem Fürsorgeverein ein paar Kleider abgejagt und die Kleine nach einer ernsten Auseinandersetzung über Ordnung und Liederlichkeit wieder in das Leben hinaus entlassen.
Читать дальше