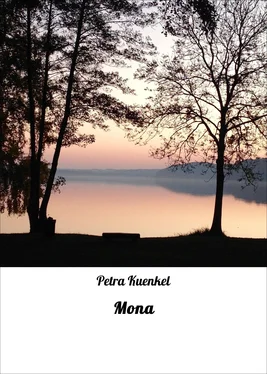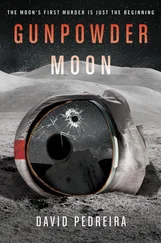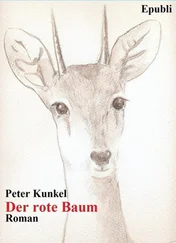Die Welt war brutal. Und wir alle mischten mit, in unserer eigenen Welt gefangen. Wenn wir mit dem Elend konfrontiert wurden, fühlten wir uns ohnmächtig. Wir wähnten uns hilflos, flüchteten in Gegenden, die uns vor solchen Anblicken bewahrten. Damit bewiesen wir uns, dass die Welt auch andere Bilder hatte, und erklärten uns, dass wir nichts tun konnten. Ich hatte plötzlich Sehnsucht nach Nina. Sie hätte eine ihrer leidenschaftlichen Reden begonnen, über die strukturellen Ursachen von Armut, über Gesellschaftssysteme, die das soziale Ungleichgewicht in Gang hielten, über die Gleichgültigkeit der Reichen gegenüber den Armen. Der Taxifahrer schien die kranke Frau gar nicht mehr wahrzunehmen. Ich wischte mir die Tränen ab.
Der Verkehr nahm zu, je weiter wir uns dem Zentrum näherten. Langsam schob sich die Blechlawine von Autos voran. Dazwischen überquerten Menschen auf wundersame Weise die Straße, mitten durch das dauerhafte Hupkonzert. Eine Frau mit zwei kleinen Kindern an der Hand balancierte ein Bündel bunter Stoffe auf der Schulter durch den Verkehr. Fahrzeuge und Menschen schienen ein unsichtbares Komplott miteinander einzugehen. Jeder durfte jederzeit die Straße überqueren und sich zwischen den Autos und Bussen durchschlängeln, als hätte das Chaos ein System, das ihnen bekannt war. Fast wie ein Morgensport, ein Roulette-Spiel, eine Herausforderung des Schicksals. Oder ein Beweis für die Kooperationsfähigkeit zwischen Autofahren und Fußgängern. Es kam mir vor wie eine selbst organisierte Ordnung, in der alle Akteure die Regeln kannten, nur ich nicht.
Auf der rechten Seite tauchte das Meer auf. Wir fuhren jetzt auf der Uferpromenade. Das Hotel konnte nicht mehr weit sein. Ein schwerer gelber Dunst hing über dem Meer, der Horizont war nicht zu erkennen. Unzählige Frachter lagen träge in der Bucht vor Anker. An der nächsten Ampel kaufte der Taxifahrer eine Tageszeitung. Er reichte sie mir nach hinten, wiegte den Kopf nach rechts und links und fragte mit seinem indischen Akzent im Englischen, ob ich Zeitung lesen wolle. Der Verkehr würde auf der Halbinsel zunehmen und es würde noch einen Augenblick dauern. Aus Höflichkeit begann ich, in der Zeitung zu blättern, aber das Bild der beiden Kinder neben der kranken Mutter ging mir nicht aus dem Sinn. Ich überflog die Titelzeilen. Es ging darum, wie aus Mumbai eine Solarstadt werden sollte. Hatte mein Nachbar im Flugzeug nicht darüber gesprochen? Ich blätterte weiter. Auf der ersten Lokalseite hielt ich inne – dort war ein Foto von ihm abgebildet. ‚Zukunftsforscher Girish Puja im Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Mumbai’, sagte die Bildunterschrift, und der Untertitel – ‘Das Unmögliche möglich machen’. Der Artikel handelte davon, aus Mumbai eine Stadt zu machen, die sich mit Hongkong oder Singapur messen konnte und zudem ihre Energie zu 100% aus Sonnenlicht bezog. Das war ein weiter Weg, dachte ich und schlug die Zeitung wieder zu.
Das Taxi hielt vor einem bescheidenen grauen Hotel mitten im Stadtteil Kolaba in einer Seitenstraße, nicht weit entfernt von der großen Uferpromenade. Ein Hotelangestellter öffnete die Wagentür, wünschte mir, wie ich fand, übermäßig freundlich einen Guten Morgen und nahm mir den Rollkoffer ab. Wieder hatte ich den Gedanken, ich müsste das Manuskript beschützen. Aber der freundliche Herr stellte mein Gepäck nur an der Rezeption ab. Die junge Dame hinter dem Tresen begrüßte mich zu meinem Erstaunen mit meinem Namen. Sie schob mir die Schlüssel für mein Zimmer entgegen und überreichte mir einen Zettel mit den Zugangsdaten für das Internet. Ich war beeindruckt.
Das Zimmer im dritten Stock konnte ich nur mit einem alten Fahrstuhl erreichen, dessen dauerhafte Fuktionstüchtigkeit ich anzweifelte. Bevor ich mir überlegen konnte, was ich tun würde, wenn ich zwischen den Stockwerken stecken blieb, ruckte es und die Tür öffnete sich ratternd. Mein Zimmer lag am Ende des Flurs, es war nicht sehr groß, aber geschmackvoll in dezenten Pastellfarben eingerichtet. Durch die leicht geöffneten französischen Fenster drang verhalten der Lärm der Stadt ins Zimmer, begleitet von einer Hitze, die mich schwer atmen ließ. Die roten Seidenkissen auf dem Bett waren so drapiert, wie ich es in Paris hätte erwarten können. Ich legte mich auf das übergroße Bett und versuchte anzukommen.
Warum machte ich diese Reise eigentlich? Ein Anruf, ein Hinweis auf Chris, eine Mischung aus Zweifel und Gewissheit, Furcht und Gespanntsein und das Gefühl, dass dies nur der Anfang von etwas Größerem war. Als Studentin war ich viel gereist. Während andere sich bemühten, Geld zu verdienen oder Praktika zu machen, war ich unterwegs gewesen. Oft ohne konkretes Ziel. Ich hatte es geliebt, mich treiben zu lassen, ein Lebensgefühl zu kultivieren, wo Momententscheidungen zählten, wo es keine festen Planungen gab. ‚Emergenz’ war heute der Fachbegriff dafür im Management. Eine Betrachtungsweise, die besonders wichtig war für Führungskräfte, die zu starr planten. Auch ich selbst hatte lange nicht mehr die Gelegenheit gehabt, die Dinge auf mich zukommen zu lassen.
Gegenüber dem Bett hing ein Bild, das wie eine Kopie von Monet wirkte. Farbtupfer, die eine Szene ergaben, aber so verwischt, dass nur ein Gefühl entstand. Sich treiben lassen, dachte ich. Das passte.
Ich beschloss, meine Zeit in dieser Stadt langsam anzugehen und jeden Augenblick zu genießen. Der Tag war für mich reserviert, ich wollte durch die Straßen schlendern, die Mengen von Menschen zwischen den eng gebauten Häusern als Eindruck aufnehmen, mich treiben lassen, ohne Zeitdruck. Dass meine Absicht durch die Verabredung mit meinem Sitznachbar aus dem Flugzeug durchkreuzt war, ärgerte mich jetzt.
2
Ich konnte die Cafés von Starbucks nicht leiden, weil sie überall in der Welt gleich waren. Dagegen liebte ich die vielen kreativen, unprofessionellen, aber liebenswerten Cafés in Berlin. Außerdem war Starbucks immer überfüllt, zu jeder Tageszeit, überall auf der Welt. Entgegen meiner Abneigung saß ich nun dort, hatte mir einen mittelgroßen Café Latte geholt und einen Platz erobert, an den sich auch eine zweite Person setzen konnte. Ich stocherte mit dem Holzstab zum Rühren in meinem aufgeschäumten Kaffee und wartete nervös. Worauf hatte ich mich hier eingelassen? Das Café war voll mit jungen Leuten, von denen sich die meisten mit ihrem Laptop, ihrem Ipod oder ihrem Smartphone beschäftigten. Im Hintergrund lief leise indische Musik. Die Welt wird sich immer ähnlicher, dachte ich, die Gesichter der Menschen sehen hier anders aus, aber sie verhalten sich nicht anders als in Berlin. Ich war wie immer zu früh und da ich ungern alleine im Café saß, holte ich das Manuskript hervor, um weiterzulesen. Ich verstand nicht, worum es ging, aber der Text reizte mich wie eine Entdeckungsreise in eine andere Welt. Sie erinnerte mich an meine Großmutter, die immer voller unerwarteter Geschichten steckte. Wenn ich sie als kleines Kind mit meiner Mutter in ihrer Wohnung in einem Berliner Hinterhaus besuchte, war es, als würde ich eine Märchenwelt betreten. Ihr einziges Zimmer war vollgestopft gewesen mit antiken Möbeln, die von vielen Umzügen leicht beschädigt waren. Wenn meine Mutter gegangen war, kochte meine Großmutter einen Zaubertee aus Hagebutten- und Pfefferminzblättern. Sie stieß mich sanft auf das Sofa mit dem Brokatüberwurf und fing an Geschichten zu erzählen. Alles im Leben war für sie eine Geschichte. Als Kind konnte ich nie unterscheiden, was Realität war und was sie erfunden hatte. Jetzt konzentrierte ich mich auf den Text.
„ Ich habe dich nicht sehen können“, sagte Morgaine mit einem verhaltenen Lächeln, als Ciarán ihre Gemächer betrat.
„ Aber ich konnte dich sehen.“ Er legte seinen Umhang auf einen Schemel und fuhr sich mit der Hand durch sein langes braunes Haar. Dann breitete er einladend die Arme aus.
Читать дальше