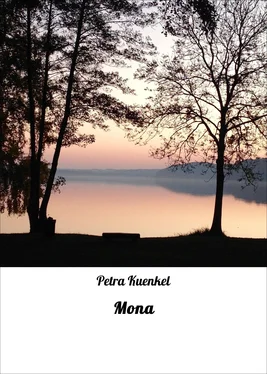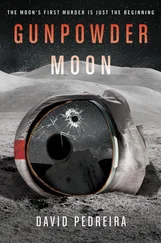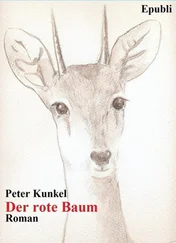Ich öffnete die Augen.
„Stimmt!“
Neben mir saß ein indischer Mann ungefähr Mitte fünfzig in einem untadeligen Anzug, sodass ich mich fragte, ob er in dieser Kleidung geschlafen hatte und wie es möglich war, dass der Anzug so korrekt saß.
„Dann können Sie gar nicht sehen, was sich in den letzten Jahren alles verändert hat in dieser Stadt.“
„Nein, das kann ich das nicht, aber ich bin gespannt zu sehen, wie die Stadt genau heute ist.“
„Ein neuer Stadtentwicklungsplan des Ministeriums für erneuerbare Energien sieht vor, dass in den nächsten Jahren ungefähr 60 Städte als „Solarstädte“ entwickelt werden sollen. Bereits heute haben 48 Städte einen Antrag eingereicht und 37 Städte Entwicklungspläne, die auf die Anerkennung des Ministeriums warten. Mumbai ist schon genehmigt. Wenn man sich nur entschließt, ist alles möglich. Man kann eine ganze Stadt verändern und auch ein ganzes Land.“
„Sicher“, erwiderte ich freundlich, „Indien hat sich ja enorm wirtschaftlich entwickelt.“
„Das meine ich nicht. Es geht nicht allein um die Wirtschaft. Ich rede vom Menschen. Wenn sich das Bewusstsein ändert, ist alles möglich.“
Ich schwieg, weil ich nicht wusste, was ich antworten sollte. In dem Moment setzte das Flugzeug auf und bremste scharf. Der Herr betrachtete mich mit einem merkwürdigen Lächeln, das mir unangenehm war.
„Wie sich die Zukunft entwickelt, hängt von unserem Denken ab“, fing er wieder an, als wir auf das Terminal zurollten. „Das meine ich.“
Ich hoffte darauf, dass das Flugzeug bald zum Aussteigen bereit wäre.
„Vertrauen ist entscheidend“, setzte er unbeirrt fort. „Man muss darauf vertrauen, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie richtig sind. Es hat alles eine Ordnung, auch wenn wir sie nicht immer verstehen.“
Der Pilot verlangsamte die Fahrt und die Maschine kam zum Halten. Mein Nachbar stand auf, zeigte auf mein Handgepäck und als ich nur kurz nickte, nahm er den silbernen Rollkoffer aus der Ablage und reichte ihn mir. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich an den Umschlag mit dem alten Manuskript, das ich eingepackt hatte, weil ich in einer ruhigen Minute auf meiner Dienstreise darin weiterlesen wollte. Mir war, als müsste ich es beschützen. Der Steward gab das Flugzeug zum Aussteigen frei. Ich nahm den Koffer mit einem Dank entgegen und verabschiedete mich mit guten Wünschen für seine Rückkehr in sein Heimatland. Er hatte mich mit seinen merkwürdigen Bemerkungen aus dem Konzept gebracht. Da er mich vorließ, stieg ich als Erste aus und lief einer anonymen Traube von Menschen voran durch das Terminal, ohne mich nach meinem Reisenachbarn umzusehen. Nun stand ich in der Schlange der Nicht-Inder vor der Passkontrolle. Immerhin gab es hier eine Klimaanlage. Die kurze Strecke zwischen Flugzeug und Ankunftshalle kündigte an, welche Hitze mich draußen erwarten würde. Hinter den Kabinen, in denen die Beamten saßen, stand weithin sichtbar in großen Buchstaben ein Zitat von Ghandi an der Wand: „Du musst selbst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen möchtest.“ Das hätte Nina gefallen.
Ich hatte beschlossen, die Reise anders anzugehen als andere Dienstreisen. Als meine Sekretärin mich darüber informierte, dass sie das Taj Mahal Hotel in Mumbai gebucht wäre, erklärte ich ihr, sie solle das Hotel stornieren. Wegen des Terroranschlags vor einigen Jahren würde ich dort nicht übernachten wollen. Sie sollte im Reiseführer nach einem kleineren Hotel suchen, das zentral läge, drei Sterne würden reichen. In Chennai würde ich dann wieder in einem Fünf Sterne Hotel übernachten. Die Tage in Mumbai wollte ich anders verbringen. Ich brauchte das Gefühl zu reisen, ein Hauch von Unbekanntem, Unbestimmbarem. Auf die Frage, wer mich am Flughafen abholen sollte, antworte ich zum Erstaunen meiner Sekretärin, niemand, ich würde ein Taxi nehmen. Der ungläubige Blick sprach für sich.
Als ich mit dem leichten Koffer vor die Halle des Flughafens trat, traf mich die morgendliche Hitze Mumbais wie ein Schlag. Nicht weit weg von mir sah ich meinen Sitznachbarn wieder und als hätte er auf mich gewartet, eilte er auf mich zu.
„Entschuldigen Sie, wahrscheinlich wundern Sie sich über mich, aber ich muss auf meine Intuition hören und sie ansprechen. Haben Sie vielleicht heute noch Zeit für ein Gespräch? Selbstverständlich an einem öffentlichen Ort. In welchem Viertel wohnen Sie?“
„In Kolaba.“
„Dann vielleicht um 15.00 im Café Starbucks, in Kolaba?“
Von der Hitze und der Situation überfordert, willigte ich ein. So schnell, wie er auf mich zugelaufen kam, war er wieder in der Warteschlange für die Taxis verschwunden, als hätte er es besonders eilig. Die Zuordnung von Passagieren für die Taxis erschien mir nicht sehr effizient und fand nach einem System statt, das sich mir nicht erschloss. Während die Schlange der Wartenden chaotisch durcheinander geriet, standen die gelben Taxis ordentlich aufgereiht vor dem Terminal. Die Fahrer lungerten in Gruppen zusammen, gestikulierten und rauchten. Mir kam es vor, als würden sie sich streiten, anstatt Gäste transportieren zu wollen. Verstört von der merkwürdigen Begegnung ging ich auf das vorderste Taxi zu. Die hintere Tür war verbeult, sodass der Fahrer kräftig ziehen musste, um sie zu öffnen. Mein Rollkoffer verschwand in einem Kofferraum, den der Fahrer mehrfach kräftig zudrücken musste, bevor das Schloss hielt. Schicksalsergeben ließ ich mich auf die durchgesessene Rückbank fallen. Auf die Frage, wohin ich wollte, nannte ich erschöpft den Namen des Hotels und ich feilschte noch einige Minuten um den Preis. Dann fuhren wir los. Endlich konnte ich Mumbai auf mich wirken lassen.
Als ich zur Schule ging, hatte mir meine Großmutter erklärt, Synchronizitäten wären Ereignisse, die aufeinander folgten ohne Kausalzusammenhang, und dennoch einen Sinn ergäben. Sie hatte mir ständig Vorträge über die Bedeutung der Intuition gehalten. Das Leben sei eine Aneinanderreihung von Nachrichten an die Seele, auf die man hören sollte. Das Universum würde einem Hilfestellungen geben, die man nur wahrnehmen müsste, damit man von Herausforderungen des Lebens lernen konnte. Erst hatte mich das fasziniert und mich auch angestachelt, Dinge einfach auszuprobieren, spontan zu sein und mich treiben zu lassen. Später hatte ich es dann als Unfug abgetan. Die täglichen Herausforderungen, Kinder und Karriere zu verbinden, entfernten mich immer weiter von dieser Art das Leben zu sehen. Und im Konzern hatte eine solche Sichtweise auf die Dinge keinen Platz. Ungelöste Fragen und Zufälle durfte es nicht geben, oder zumindest sollte man nicht laut sagen, dass es sie gab. Der Moment, an dem ich wusste, dass ich nach Mumbai fahren würde, war wie eine Erinnerung an diese andere Art und Weise in der Welt zu sein. Und jetzt auch noch das Treffen mit meinem Sitznachbarn. Es hätte in die Geschichten meiner Großmutter gepasst.
Wir fuhren in die Morgendämmerung hinein auf die Stadt zu. Überall schliefen Menschen auf der Straße. Rechts und links der Fahrbahn und auf dem Mittelstreifen, auf Pappkartons, manche auf Matratzen, manche auf dem nackten Boden, viele Mütter mit Kindern. Ich begann zu zählen. Als ich schon nach wenigen Minuten über hundert war, gab ich auf. Sollte ich den Taxifahrer fragen, ob es hier immer so viele Obdachlose gab? Ich beschloss zu schweigen und einfach zu beobachten. Was wusste ich schon von Indien? Was wussten wir Menschen überhaupt voneinander? Ich versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, in Mumbai auf der Straße zu leben, eine alte Matratze und einen Gehweg mein Zuhause zu nennen. Wo würde ich mich waschen? Wie würde ich Schutz suchen? Ich hatte seit Jahren nicht mehr Zeit gehabt, eine fremde Stadt auf mich wirken zu lassen. Meistens war die Fahrt zwischen Flughafen und Fünf-Sterne-Hotel vollgepackt mit Arbeitsbesprechungen oder Telefonaten. Und anders als meine Tochter war ich nicht der Typ, der sich grundsätzlich mit den Schwachen dieser Welt identifizierte. Ich erwischte mich bei dem zynischen Gedanken, wie es wäre, mich und einige Manager aus unserem Konzern einmal mit einer solchen Erfahrung zu konfrontieren. Ein paar Tage in Mumbai auf der Straße leben. Sich von Almosen ernähren. Lernen zu betteln, lernen, um Unterstützung zu fragen. Lernen, dabei das eigene Selbstwertgefühl nicht zu verlieren und die eigene Identität, den Glauben an sich selbst nicht von der Größe des Dienstwagens abhängig zu machen. Die Gedanken halfen mir nicht – was ich sah, war unerträglich. Als wir an einer Verkehrskreuzung kurz hielten, sah ich zwei kleine Kinder, die neben einer liegenden Frau hockten. Sie bewegte sich nicht und starrte mit offenen Augen in die Weite. Sie musste schwer krank sein. Das Mädchen von vier oder fünf Jahren mit zerzausten Haaren und einem braunen dreckigen Kleid saß dicht an die Frau gedrängt und legte ihren Kopf auf deren Brust. Der Junge, nur wenig älter, barfuss, in Shorts und einem ebenso verdreckten hellblauen Hemd, hockte etwas abseits, als würde er warten und wissen, er könnte nichts tun. Ein Passant lief vorbei und warf dem Jungen ein paar Münzen hin, die er gierig einsammelte. Ich schluckte, als das Taxi wieder anfuhr, Tränen schossen mir in die Augen.
Читать дальше