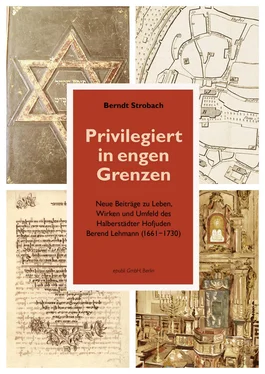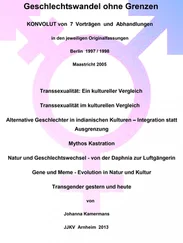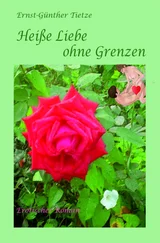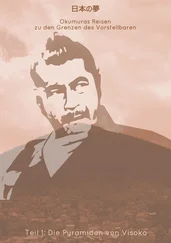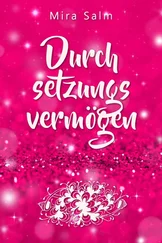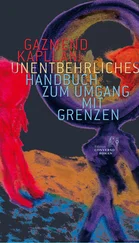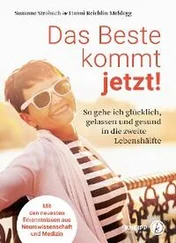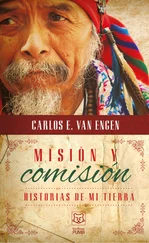So entwickelt er insgesamt ein dichteres und erheblich konkreteres, wenn auch noch durchgängig makelloses Bild Berend Lehmanns.
Es gibt für die Frage, wie objektiv ein Autor Berend Lehmann gegenübersteht, mehrere Test-Episoden, von denen eine im folgenden untersucht werden soll: Bei einer Hungersnot im Winter 1719/1720 gelang es Lehmann, aus Polen und Russland Brotgetreide zu beschaffen, das zu einem erhöhten Preis an die sehnsüchtig wartende Bevölkerung verkauft werden konnte. Als wieder einheimisches Getreide vorhanden war, das zum Normalpreis hätte abgegeben werden können, soll Lehmann beim Kurfürsten die Anordnung erreicht haben, dass der Rest seines Getreides trotzdem zum erhöhten Preis abgenommen werden musste. So die Behauptung einer zeitgenössischen christlichen Quelle.
Emil Lehmann hält sie, ohne ihren Wahrheitsgehalt überprüfen zu können, für eine antijüdische Lüge und kommentiert seine Annahme so: “Die Tatsache steht jedenfalls fest, daß Lehmann und Meyer [Lehmanns Schwager und Kompagnon] in Zeiten der Hungersnot durch intelligente Maßnahmen Abhilfe und billiges Korn herbeiführten. Daß ihre Unternehmungen Neid und Anfeindungen begegneten – wen sollte das Wunder nehmen?“ 34
Dass Emil Lehmann seinen Urahn leicht idealisiert, zeigt auch sein Kommentar zu Berend Lehmanns Appell an August den Starken, keine neuen, möglicherweise schädlichen Juden in Sachsen zuzulassen: „Dieser Eingabe lag nicht Konkurrenzneid – dazu war Berend Lehmann viel zu großherzig – [...]zugrunde [...]“. 35
Zwar wusste man auch vor Emil Lehmann schon manches über den Mäzen, den Geschäftsmann, den Verhandlungsdiplomaten, aber beinahe nichts über den Menschen Berend Lehmann. Jetzt war für den sensiblen Leser aus den von Emil Lehmann publizierten Eingaben und Briefen durchaus Persönliches herauszulesen: Neben Berend Lehmanns Stolz auf Herkunft und Leistung sprechen sie von dem deutlichen Bewusstsein der Beschränkung, der er als Jude unterworfen war, sogar als einer der Höchstprivilegierten.
Die Briefe offenbaren zudem eine große taktische Beweglichkeit im Umgang mit den christlichen Herrschern: Einerseits pocht er darin auf Recht und Verdienst, andererseits findet sich der ständige klagende Hinweis auf die Gefährdungen für Ruf und Kredit, bis hin zu einem demütigen Jammern mit Floskeln vom darbenden Weib und den Kindern. Das will zwar gar nicht in das innerjüdisch tradierte Bild des stolzen Fürsprechs passen, aber es war wohl ein Verhaltensmuster, das in den Jahrhunderten des Ausgeliefertseins als ultimative Rettungsmaßnahme erlernt worden war.
Diese Fähigkeit des berühmten Hofjuden, sich im Notfall auch selbst zu verleugnen, wurde denn auch von nachfolgenden Autoren weitgehend ignoriert.
Max Freudenthal (1868–1937)
Der zunächst in Dessau und später in Nürnberg tätige Oberrabbiner Max Freudenthal hat mehrfach in seinen umfangreichen historischen Forschungen Berend Lehmann als Mäzen hebräischen Druckens dargestellt. Das geschah zuerst in seiner Geschichte der ursprünglich von dem Dessauer Hofjuden Moses Benjamin Wulff erworbenen und über 30 Jahre von dem Jeßnitzer Drucker Israel Abraham betriebenen Offizin 36*.
Dort wird die von Auerbach bereits angedeutete Fürsorge, mit der Lehmann die Werke seiner Klausgelehrten zum Druck brachte und finanzierte, ausführlich dokumentiert. Bei Freudenthals Charakterisierung der Werke wird allerdings klar, daß der Halberstädter Hofjude hebräische Literatur hauptsächlich nach ihrem traditionellen Ruf bewertete, ohne ihren Wert selbst beurteilen zu können oder zu wollen. Das Mäzenatentum war für ihn die selbstverständliche Konsequenz seines Reichtums, und je größer die rabbinische Gelehrsamkeit, so schien es Lehmann nach der Darstellung Freudenthals, desto nützlicher und förderungswürdiger war sie für die jüdische Gemeinschaft.
Wichtiger noch ist eine Artikelserie, die Freudenthal 200 Jahre nach der Lehmann-Gottschalkschen Talmud-Neuausgabe von 1697−99 verfasste 37und in der er zum ersten Mal aufgrund genauer Aktenkenntnis die geschäftliche Seite dieses Unternehmens und der Frankfurt-Amsterdamer Nachfolgeedition darstellte, bei der Berend Lehmann in der harten Auseinandersetzung mit dem Drucker/Verleger Gottschalk als zäher und unerbittlicher Prozessgegner sichtbar wird. Auch dieser Aspekt des kämpferischen Kaufmanns wurde später im Gefolge der Auerbach-Marcus-Lehmannschen Heldenverehrung von manchem Biographen (z.B. Saville, Manfred R. Lehmann) nicht in das Berend-Lehmann-Bild aufgenommen.
Josef Meisl (1882–1958)
Der Berliner Archivar Josef Meisl, nach seiner Emigration Begründer der Jerusalemer Central Archives for the History of the Jewish People, veröffentlichte 1924 sechzehn Briefe aus dem Dresdner Staatsarchiv, die Berend Lehmann zwischen 1697 und 1704 aus Halberstadt und Leipzig, teils aber auch während des Nordischen Krieges von den baltischen Kriegsschauplätzen an einen einflussreichen Dresdner Hofbeamten geschickt hatte (die so genannten Bose-Briefe). In ihnen geht es hauptsächlich um von Lehmann gegebene oder vermittelte Anleihen und um deren Sicherheit, gelegentlich auch um die militärische und politische Lage.
Meisls einleitender Kommentar zu diesen Dokumenten ist knapp und distanziert, hier ist keine Spur mehr von „Lehmann-Panegyrik“. So steht Meisl zum Beispiel der Auerbachschen Behauptung, Lehmann habe die Krönung Augusts des Starken zum Polenkönig im Wesentlichen finanziert, skeptisch gegenüber und versucht, den wirklichen Anteil des Residenten an dem Kollektivunternehmen auszumachen.
Darüber hinaus wagt er es als erster wesentlicher Biograph Lehmanns, sich auch kritisch über ihn zu äußern, indem er bei der Besprechung der Kriegsbriefe bemerkt: „Was Lehmann über die Kriegslage, namentlich über die Belagerung Rigas zu berichten weiß, ist nicht von sonderlicher Wichtigkeit. Seine Mitteilungen sind offenbar allzu rosig gefärbt und tragen einen mit den Tatsachen in Widerspruch stehenden Optimismus zur Schau.“ 38
Auch gibt Meisl als erster Autor die abfällige Äußerung einiger Hannoverscher Hofbeamter über Lehmann wieder, er sei „bekanntermaßen [...] ein großer Schwätzer, von dem man befürchten müsste, dass er desavouiert [ihm nicht geglaubt] werden dürfte“, 39und zwar tut er das ohne den gleichzeitigen Versuch aller anderen jüdischen Biographen (bis hin zu Saville), den Residenten sofort in Schutz zu nehmen.
Wichtig für ein erweitertes und ungeschminktes Bild des berühmten Hofjuden war der Ton der originalen Brieftexte. Lehmanns hier nun in größerem Umfang vorliegende schriftliche Äußerungen konnten dem aufmerksamen Leser zum Beispiel ein Leitmotiv seines Lebens bestätigen, das sich schon in den Zitaten bei Emil Lehmann angedeutet hatte: die bohrende Sorge um die Erhaltung des Reichtums, die ständige Unruhe angesichts der selbst für ihn als Bankier schwer zu überschauenden, risikoreichen Geschäftsvorgänge.
Die von Meisl veröffentlichten Briefe sind übrigens, soweit sie aus Halberstadt stammen, in gutem Französisch abgefasst und möglicherweise von einem Sekretär konzipiert. Diejenigen aus dem Baltikum, sicherlich von ihm selbst verfasst, sind in einem recht unbeholfenen und grammatisch fehlerhaftem Deutsch geschrieben. Das hätte denjenigen Lehmann-Verehrern, die seit Marcus Lehmann einen von Leibniz persönlich in Philosophie unterrichteten Hochgebildeten vor Augen hatten, zu denken geben müssen. Aber ähnlich wie Emil Lehmanns Aufsatz ist auch Meisls Beitrag offensichtlich nur selektiv zur Kenntnis genommen worden.
Ernst Frankl (geboren 1909)
Der Halberstädter Rabbinersohn und spätere Arzt Ernst Frankl verfasste als 18-Jähriger einen Zeitschriftenaufsatz über die Geschichte der Halberstädter Juden, 40in dem er Berend Lehmann folgendermaßen bewertet: „Unbedingte Pflichttreue, strenge Ehrbarkeit sind die Vorzüge seines Charakters. Man warf anderen Hofjuden Unehrlichkeit vor, man beschuldigte sie, dass sie sich bei ihren Handlungen zu oft von Habgier und Gefallsucht leiten ließen. Behrend Lehmann wagte man nicht so leicht anzugreifen.“
Читать дальше