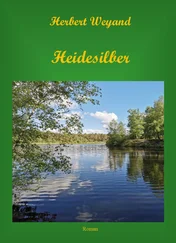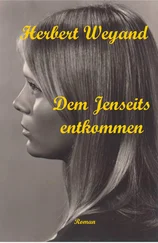Herbert Weyand - Die vergessenen Kinder
Здесь есть возможность читать онлайн «Herbert Weyand - Die vergessenen Kinder» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die vergessenen Kinder
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die vergessenen Kinder: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die vergessenen Kinder»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Beim Abriss des Feuerwehrhauses wird eine riesige autarke Bunkeranlage entdeckt. Einundzwanzig tote Kinder liegen in einem Schutzraum.
Die polizeilichen Ermittlungen ergeben sehr schnell, dass die Toten nicht die sind, die 1944 bei einem Luftangriff verschüttet wurden.
Haben die Kinder damals den Luftangriff überlebt?
Die vergessenen Kinder — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die vergessenen Kinder», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wir haben einige Karbidlampen, von denen ich eine Zweite anzünde. Die andere muss bei Tilde und den Kindern bleiben. Ich gehe weiter in den Keller hinein und verschwinde hinter einem Vorsprung. Dazu muss gesagt werden, dass der Schutzkeller aus vier Räumen, die im Quadrat liegen, besteht und vielleicht auch als Keller für ein Haus dienen sollte. Aber nein, er besteht ja aus Kunststein, diesem Gemisch aus Sand, Steinen und Zement und dazu gusseiserne Streben. Die Decke ist nach oben gewölbt. Dadurch hält sie eine größere Drucklast. Die hintere Wand des Raumes ist eingestürzt. Die Decke wird jedoch von der Eiseneinlage gehalten. Vorsichtig räume ich Gesteinsbrocken beiseite. Sand rieselt nach. Schließlich stößt meine Hand ins Leere. Hastig räume ich mehr Schutt beiseite und leuchte mit der Lampe in ein dunkles Loch, einen weiteren Raum, den ich nicht vermutet habe. Es dauert einige Zeit und viel Kraftaufwand, bis ich den Durchbruch so weit erweitere, dass ich durchsteigen kann. Der dahinter liegende Raum ist nicht so unversehrt geblieben, wie der vordere Schutzkeller. Die Erschütterungen der Bomben – vielleicht ist auch eine direkt drauf geknallt - haben dicke Betonbrocken von der Decke gelöst. Ich überlege umzukehren, gehe jedoch vorsichtig tastend weiter. Wie sich später erweist, ein glücklicher Umstand. Der Einbruch hier ist älteren Datums. Die Bruchstellen an den Brocken sind nicht frisch. Ich zwänge mich durch einen Spalt, jeden Augenblick darauf gefasst, dass weitere Brocken sich lösen und mich zerquetschen. Plötzlich stehe ich frei in einer großen Halle und bestaune Tonnen von Lebensmitteln, die in Regalen lagern.
Meine Gefühle, in diesem Moment, kann ich schlecht beschreiben. Vor wenigen Minuten, so gut wie sicher zum Tode verurteilt und jetzt ein Funken Hoffnung.
Die Decke in dem ungefähr zweihundert Quadratmeter großen Raum wird von mächtigen Stützen getragen. An den Wänden gehen Türen ab, die gleichzeitig Schleusen sind, wie ich an den Dichtungen sehe. Also eine Tür öffnen, einen kleinen Vorraum betreten, der maximal drei Personen fasst, die Türe wieder schließen und die folgende öffnen. Die zweite Türe bleibt verriegelt, solange die Erste geöffnet ist.
Ich öffne also Türen und finde Räume, die unterschiedlichen Nutzungen dienen. Teils Büros, teils Aufgaben, die ich noch nicht erkenne. Eine Schleuse öffnet einen längeren Gang von ungefähr zwei Meter Breite. Ich folge ihm und finde wohnliche Räume, von denen es in Schlafkabinen geht, die entlang der Wände, in die Tiefe, angeordnet sind. Je ein Bett und eine Ablage. Auf dem Boden liegt Linoleum in verschiedenen Farben, der offensichtlich ein Synonym für die entsprechende Nutzung ist. Ich folge dem braunen Belag, der vor den Schlafkojen unendlich entlang läuft. Ich zähle einhundert Kabinen von ungefähr sechs Quadratmetern Größe. Zwischen jeweils zehn Schlafgelegenheiten liegt ein Gemeinschaftsbad. Wasser läuft keins, als ich an einem Rad drehe. Es wäre ja zu schön.
Ich kehre in den Wohnraum zurück, den ich als Erstes betreten habe und überlege. Ehrlich gesagt bin ich total erledigt und setze mich auf einen Stuhl. Mein Bein schmerzt ob der ungewohnten Belastung. Jetzt bekomme ich es auch mit der Angst zu tun. Niemand, wirklich niemand im Dorf hat jemals über diese Anlage gesprochen, von der ich noch nicht weiß, wie groß sie ist. In welch eine Geschichte bin ich hier hineingeraten? Klar, die Nazis geistern seit Jahren durch die Gegend und da ist auch noch der Flugplatz drüben in der Heide. Wenn der Einbruch der Decke nicht wäre, niemand hätte je davon erfahren, außer den Erbauern natürlich. Für uns ist diese Anlage, die Chance zum Überleben.
Am besten hole ich Tilde und die Kinder hierhin. Vielleicht dauert es ein paar Tage, bis wir befreit werden. Niemand von uns weiß, was dort oben los ist.
„Haben Sie von diesem Bunker gewusst“, fragt Tilde Stunden später, nachdem die Kinder versorgt und zu Bett gebracht sind.
„Nein“, ich schüttele den Kopf. „Aber es ist merkwürdig, dass niemand im Dorf jemals etwas davon gesagt hat.“
„Ich habe Angst und will hier raus. Ich kann nicht atmen.“ Sie fasst mit der Hand an den Hals. Der Puls rast und ist an der Halsschlagader sichtbar.
„Es kann nicht mehr lange dauern und wir werden gerettet.“ Ich strahle Optimismus aus, den ich nicht empfinde. Ich würde sie gern in den Arm nehmen und halten. Aber sie ist verheiratet und es schickt sich nicht.
Was, wenn die Verwüstungen über uns derart sind, dass jemand auf die Idee kommt, hier könne niemand mehr leben. Dann sitzen wir hier mit den Kindern. Fünfzehn von ihnen sind älter als sechs Jahre und vierzehn jünger. Aber keines mehr als zehn. Wasser ist im Moment auf einige Kanister begrenzt. Doch ich bin der festen Überzeugung, dass ich welches finde, denn um Nahrung müssen wir uns keine Sorgen machen.
Aber welchen Sinn macht es, möglicherweise weiterzuleben? Der Gedanke an die verwüstete Landschaft über uns festigt sich und irgendwie weiß ich: Ich muss uns selbst rausbuddeln. „Wir schlafen jetzt und morgen früh oder welche Zeit wir haben, mache ich mich noch einmal auf die Socken. Vielleicht gibt es doch einen Ausgang.“
In der Nacht, also während der Schlafperiode, gibt es einen kurzen trockenen Schlag. Ich weiß sofort Bescheid, das Hangende ist heruntergekommen. Ich denke in den Fachausdrücken des Bergbaus. Irgendwo hat die Decke nachgegeben. Wie sich herausstellt im Durchgang zum ursprünglichen Schutzkeller. Wir haben Glück im Unglück. Ohne diesen neuen Keller wären wir tot. Jetzt sind wir jedoch endgültig abgeschnitten.
„Ihr müsst keine Angst haben“, beruhige ich zu Beginn der Wachperiode Tilde und die Kinder, die ihre Situation nicht verstanden. Gedanklich habe ich die Zeit schon in Schlaf- und Wachperiode eingeteilt, irgendwo muss ich beginnen. Wir werden durchhalten. „Tilde wird euch jetzt Aufgaben aufgeben, die ihr bitte widerspruchslos ausführt. Wer nicht gehorcht, wird bestraft. Wir müssen, wenn wir überleben wollen, zusammenhalten.“ Ich sehe ihnen in die großen angstvollen Augen und mir blutet das Herz. Tapfer widerstehen sie den Tränen. Der Ton, den ich anschlage, kommt an. „Du bist Stefan?“ ich zeige auf einen von den größeren Jungen, der nickt. „Und du, Christel“, ich nicke dem Mädchen zu. „Ihr begleitet mich bei der Erkundung des Kellers. Und du, Friedrich, besorgst nachher Reis aus dem Lager. Damit bauen wir eine Uhr. Du hast dann die Aufgabe, die Zeit festzuhalten.“
Wir packen diverse Werkzeuge zusammen und zünden die Karbidlampen an. Dann machen wir uns auf den Weg. Die Keller, die wir durchqueren, sind vollgepackt mit Dingen des täglichen Gebrauchs. Wir könnten ein unbekanntes fernes Land besiedeln. Hoffentlich bleibt es nicht diese Unterwelt. Ich muss Wasser finden.
„Irgendwo kommt hier Luft herein. Sonst wären wir schon erstickt und die Lampen würden nicht brennen“, murmele ich.
„Von dort kommt ein Luftzug.“ Christel zeigte die Regale entlang.
„Ich spüre nichts. Bist du sicher?“ Ich mustere das ungefähr ein Meter zwanzig große Mädchen mit den braunen Locken. Sie ist die Tochter eines Glasarbeiters und wohnt in meiner Nähe.
Christel nickt.
„Geh voraus, solange du den Zug spürst.“
Einige Male bleiben wir stehen, wenn Christel die Nase wie ein witterndes Tier in Luft hebt. Mittlerweile haben wir mehrere kleinere Tore und Räume passiert. Überall liegen kleine Betonbrocken auf dem Boden, die jedoch keinerlei Anlass dazugeben, der Keller könne einstürzen.
„Hier ist das Wetter stark. Ich bemerke es jetzt auch.“ Kurze Zeit später stehen wir in einem Keller, in dem die Luft stark aus einem Loch in der Wand bläst. Aus der gleichen Mauer kommen Rohre unterschiedlicher Stärke, die zu dicken Regelventilen laufen und in einer Art Verteiler in verschiedenen Deckenkanälen enden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die vergessenen Kinder»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die vergessenen Kinder» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die vergessenen Kinder» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.