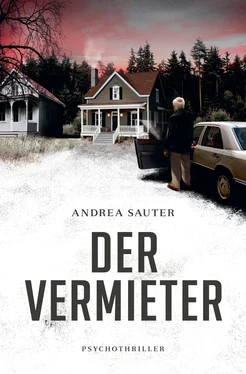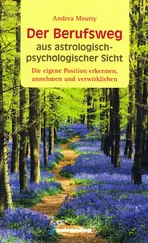Ihr fiel ein, dass Mr. Finch erwähnt hatte, dass er Diabetiker sei. Ausserdem war ihr vorher, als er die Schuhe ausgezogen hatte, aufgefallen, dass er antibakteriell ausgerüstete Diabetikersocken trug.
Er musste sich bestimmt Insulin spritzen, sonst könnte er wohl kaum vier Sahnetörtchen in sich hineinstopfen und dazu eine halbe Flasche süssen Likör konsumieren.
Sie könnte ihm also eine Insulinspritze verpassen, wenn er versuchen würde, sie anzugreifen. Mit einer Überdosis Insulin würde er in ein diabetisches Koma fallen.
Erneut durchsuchte sie die Badschränke. Dabei erschrak sie, als sie zufällig in den Spiegel blickte. Ihr Gesicht war ganz weiss.
Es fällt bestimmt auf, dachte sie, dass ich schon so lange im Badezimmer bin. Zur Tarnung drückte sie die Klospülung. In der rauschenden Geräuschkulisse, die daraufhin eintrat, glaubte Jessica ein Kind weinen zu hören.
Schnell verliess sie das Bad.
»Ist hier irgendwo ein Kind?«, wollte Jessica wissen, als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte.
»Was für ein Kind?«, fragte Mr. Finch. »Meinen Sie etwa ein Kind im Ohr?« Ein schallendes Gelächter brach aus ihm heraus und übertönte das Kindergeschrei, das sich Jessica offensichtlich nur eingebildet hatte.
Jessica schluckte leer. Sie setzte sich wieder hin und starrte erneut auf die Tasse. Dann sah sie, dass die Tasse von Mr. Finch ebenfalls mit einem Froschkönig versehen war.
»Ich muss jetzt auch mal schnell austreten. Aber nicht für kleine Mädchen, sondern für kleine Jungs«, sagte Mr. Finch, der aufgestanden und hinter sie getreten war, ohne dass sie es gemerkt hatte.
Jessica lächelte schwach. Meine Nerven sind wirklich nicht mehr die besten, dachte sie. Ich bilde mir immer mehr Dinge ein. Ich vermute eine Verschwörung hinter einer harmlosen Tasse, die mit einem Frosch bemalt ist. Ich höre schreiende Kinder, wo keine sind.
Sie drehte sich um. Irgendwie spürte sie, dass Mr. Finch sie beobachtete. Und tatsächlich, er hatte den Raum noch gar nicht verlassen. Er stand im Türrahmen und lächelte amüsiert.
»Ich glaube, der Zopf war lange genug im Ofen«, sagte er.
Jessica nickte nur müde.
Vielleicht bewahrt Mr. Finch das Insulin im Kühlschrank auf, schoss es ihr durch den Kopf, als der alte Mann doch noch im Badezimmer verschwand.
Rasch erhob sich Jessica und eilte in die Küche. Dort öffnete sie den Kühlschrank und inspizierte den Inhalt. Eine Flasche Ahornsirup, zwei Joghurtbecher, eine Schachtel mit Eiern, ein verschimmelter Käse, eine angebrochene Packung Schokolade und vertrocknete Radieschen. Keine Medikamente, die Mr. Finchs Leben retten oder ihn umbringen könnten.
Als die Klospülung ertönte, raste sie ins Wohnzimmer zurück und schaffte es knapp, auf der Couch Platz zu nehmen, bevor Mr. Finch eintrat.
Der alte Mann liess sich ächzend in den Sessel fallen. »Was rein geht, das muss auch wieder raus«, sagte er und schenkte sich ein weiteres Glas Likör ein.
Jessica machte ein angewidertes Gesicht.
Mehr um die Stille zu unterbrechen, als aus wirklichem Interesse, fragte Jessica: »Wie geht es Ihrem Diabetes?« Jessica wollte fröhlich und unbesorgt klingen, schien es aber nicht zustande zu bringen. Sie merkte, wie ihre Stimme zitterte.
»Den habe ich ganz gut im Griff«, antwortete Mr. Finch. »Ich muss viel Insulin spritzen«, fuhr er plötzlich im Flüsterton fort, »damit ich mir die vielen Süssigkeiten, die ich so gerne mag, leisten kann.« Er machte eine wegwischende Handbewegung. »Wenn das mein Arzt wüsste!«
Jessica nickte nur. Sie war ja nicht um das Wohl des alten Mannes besorgt. Es war ihr völlig egal, wie viel Süsses er in sich hineinstopfte. Je mehr, desto besser.
Mr. Finch hatte sich wieder zu Jessica hinübergebeugt. Sein Gesicht war gespannt und erwartungsvoll, wie das eines kleinen Jungen. Jessica roch den süsslichen Likör, von dem die wulstigen Lippen noch feucht waren.
Dann fragte er unvermittelt: »Wo sind Sie eigentlich aufgewachsen?«
Jessica wäre fast auf den Boden gerutscht, so sehr erschrak sie über die Frage.
»In ..., in Texas«, log sie.
Mr. Finchs buschige Augenbrauen hoben sich. »Sie haben aber gar keinen texanischen Akzent«, stellte er fest.
»Den habe ich mir abgewöhnt«, sagte Jessica schnell, »nachdem meine Eltern nach Los Angeles gezogen sind. Vor allem deshalb, weil ich in der Schule wegen meines starken Akzents gehänselt wurde. Die Mitschüler haben mich ständig nachgeäfft.«
Jessica war beim Lügen in Fahrt gekommen. Sie erzählte Mr. Finch ihren familiären Hintergrund. Ihr Vater habe ein eigenes Orchester gehabt, was zufällig sogar stimmte, ihre Mutter wäre mit Begeisterung jeden Marathon mitgelaufen, was selbstverständlich nicht stimmte. Ihre Mutter war, nach Jessicas sechstem Lebensjahr, nie wieder neben ihr gestanden, geschweige denn gelaufen.
Ihre Grossmutter stamme aus Neuseeland, mit ihr zusammen habe sie die halbe Welt bereist. Das war absolut gelogen. Ihre Grossmutter litt an Agoraphobie, sie hätte ihre Wohnung unter keinen Umständen verlassen.
Alles andere, was folgte, war ebenfalls blanker Unsinn. Sie sammle seit ihrer Kindheit Weinetiketten, sie habe damals ihr ganzes Kinderzimmer damit tapeziert.
Mr. Finchs Gesichtsausdruck veränderte sich. Er kniff die Augen zusammen und sah Jessica misstrauisch an.
»Das ist sehr interessant.« Mr. Finch hielt inne, als versuchte er, sich an etwas zu erinnern. Dann sagte er: »Ich glaube, jetzt muss ich den Zopf endlich aus dem Ofen holen. Was mögen Sie lieber, Marmelade oder Honig?«
Ich muss ihm endlich sagen, fiel Jessica ein, dass er mich künftig nicht mehr belästigen soll. Er solle weder an meiner Tür läuten, geschweige denn mich um sechs Uhr morgens anrufen.
Aber als sie den Mund öffnete, um ihr Anliegen kundzutun, schrak sie zusammen. Die Pendeluhr, die hinter ihr an der Wand hing, schlug sechsmal. Ihr verrostetes Laufwerk klang wie das Scheppern von Kochtöpfen. Jessica erlitt dabei fast einen Hörschaden.
Noch zitterte der letzte Ton des letzten Schlages durch das Wohnzimmer, als Jessica sich erhob und einen Schwall erfundener Pflichten aufzählte, denen sie sofort nachgehen müsse.
Sie hielt es keine Minute länger in diesem Haus aus und verwarf den Gedanken, dem Vermieter ihre Meinung zu sagen. Stattdessen schnappte sie sich die Handtasche und ging in schnellen Schritten zur Tür. »Danke für den Kakao, Mr. Finch«, rief sie über ihre Schulter nach hinten.
Der sonst so träge wirkende alte Mann holte sie aber sofort ein und umklammerte Jessicas Arm.
»Sie wollen schon gehen?«, fragte er mit vorwurfsvollem Unterton.
»Ja, leider«, sagte Jessica schnell.
»Aber für ein Stück Brotzopf haben Sie doch bestimmt noch Zeit«, sagte Mr. Finch.
»Nein, glauben Sie mir, ich kann nicht länger bleiben! Es war ein ganz reizender Abend und die heisse Schokolade war wirklich köstlich.«
»Das finde ich auch«, stimmte Mr. Finch zu. »So ein Kaffeekränzchen müssen wir öfters veranstalten.« Mit seinen kühlen Fingern berührte er ihre linke Wange und sagte: »Gute Nacht, Prinzessin.«
Ein Schauer lief Jessica über den Rücken. Ihr wurde plötzlich bewusst, dass sie Angst vor Mr. Finch hatte.
Als sie draussen war, schaute sie noch einmal kurz hinauf zu den Fenstern von Mr. Finchs Haus. Der Vorhang bewegte sich. Der Vermieter stand dort und starrte ihr nach. Jessica zuckte zusammen. Dann begann sie zu rennen, bis sie schliesslich nach Luft schnappend vor ihrer Haustür stand. Mit zittrigen Fingern zog sie den Schlüssel aus der Handtasche und liess ihn fallen. Jessica fluchte und bückte sich, um ihn aufzuheben. Dann schloss sie auf, trat ins Haus und verriegelte hastig die Tür.
In der Küche schenkte sie sich zuerst ein halbes Glas Whisky ein und zündete eine Zigarette an.
Читать дальше