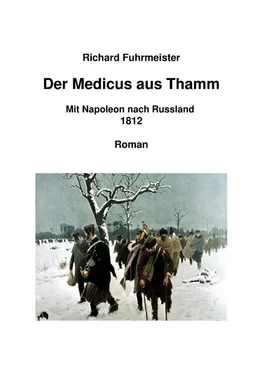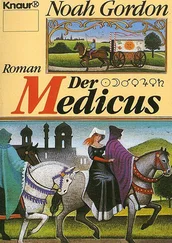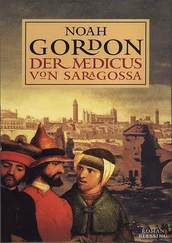Prell und Christoph, die froh waren, eine Unterkunft gefunden zu haben, sahen einander kurz an, lachten und antworteten fast gleichzeitig:
„Nein, das macht uns nichts aus.“
Christoph ergänzte:
„Wir haben jetzt vier Wochen unter einem Dach gewohnt. Da können wir leicht auch eine Nacht im selben Zimmer verbringen.“
„So ist es.“, bestätigte Prell.
Preiswert wie das Zimmer war auch das köstlich zubereitete Abendessen, das sie ebenso wie den vortrefflichen Weißwein nach der langen Tagesreise genossen. Prell wollte Christoph unbedingt einladen, der sich gegen diese erneute Großzügigkeit aber energisch wehrte.
Schon bald nach dem Essen verließen sie die überfüllte Gaststube und stiegen die ausgetretenen Steinstufen zu ihrem Zimmer im ersten Stock hinauf. Beide waren zu müde, um sich an dem leicht muffigen Geruch in dem schlecht gelüfteten Raum zu stören. Nach ein paar Bemerkungen über den vergangenen Tag, aber auch über die politische und militärische Lage verstummten sie nach kurzer Zeit, wünschten einander eine gute Nacht und waren alsbald eingeschlafen.
Gewaltige, schnell aufeinanderfolgende Detonationen erschütterten am nächsten Morgen, als die beiden noch etwas verschlafen beim Frühstück saßen, Boden und Wände der Gaststube. Erschreckt fuhren sie hoch. Alle im Raum rannten auf die Straße. Der Wirt stürzte hinterher und rief:
„Meine Herren, beruhigen Sie sich! Kein Grund zur Aufregung! Die Franzosen sprengen unsere Stadtmauern. Ich habe gestern vergessen, Sie vorzuwarnen. Verzeihen Sie!“
Nachdem sich alle beruhigt hatten, spottete der Wirt:
„Napoleon will wohl vorsorgen. Eilig, wie er es immer hat, sollen die Stadtmauern seinen Einmarsch in Wien nicht noch einmal behindern und verzögern, wenn er uns das nächste Mal mit seinem Besuch beehrt.“
Prell wartete, bis die Mineure, die ihr Handwerk meisterlich beherrschten, die Sprengungen beendet hatten und alle Straßen wieder passiert werden durften, und brachte dann Christoph in seinem Einspänner zum Regiment nach Oberdöbling. Er verabschiedete sich mit großer Herzlichkeit. Christoph versicherte ihm, das geliehene Geld schnellstmöglich zurückzuzahlen.
„Das weiß ich doch.“, wiegelte Prell ab. „So oder so, wir werden uns immer über Ihren Besuch freuen.“
Nach Wien kam Christoph nur noch einmal und konnte so bloß einen Teil der prächtigen, eindrucksvollen Bauten der Kaiserstadt bewundern. Reges Treiben und die farbenfrohe Vielfalt der Uniformen erfüllten die Promenaden, Gassen und Plätze und belebten sie mehr noch als in Friedenszeiten. Christoph bedauerte, nicht häufiger in die Stadt zu kommen, auch weil alles wohlfeil zu kaufen war, da der Wert des Papiergeldes so stark gesunken war, dass man für einen Dukaten bis zu achtzig Gulden erhielt. Ein gutes Mittagessen kostete ebenso wie die Flasche Wein dazu jeweils einen Gulden.
Einige Monate früher, Ende Mai, wäre es ihm bei einem Besuch Wiens weitaus weniger gut ergangen, berichtete Christoph ein Unterarzt seines Regiments, der nicht wie er im Sankt Pöltener Hospital Dienst tun musste, sondern gleich mit dem Gros der Truppen nach Wien mitgezogen war. Er erzählte, wie es damals zu einer drastischen Teuerung kam und eine Hungersnot in der Stadt ausbrach. Vor allem litten die Einwohner unter dem Mangel an Brot, das sie nur überteuert und nach stundenlangem Warten vor den Bäckereien ergattern konnten. Die Fleischerläden öffneten nur unter Polizeischutz, um sich des Ansturms der Hungernden zu erwehren.
Es war am dritten Tag seines Aufenthalts in Oberdöbling, als sich etwas ereignete, das, wäre es von Erfolg gewesen, Christophs Leben und dem Schicksal Europas eine Wendung gegeben hätte, die von Millionen herbeigesehnt wurde, an die aber kaum jemand noch glaubte: Napoleon, der in Schönbrunn eine Truppenparade abnahm, wäre beinahe einem Attentat zum Opfer gefallen. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht in Wien und hinaus bis in Christophs Standquartier.
Ein junger Deutscher, Friedrich Staps mit Namen und Sohn eines Pfarrers, war eigens aus Erfurt angereist, um vor allem Deutschland vom Joch des verhassten Franzosenkaisers zu befreien, dem er die Schuld an allem Leid und aller Not in seinem Heimatland gab. Bevor er aber zu Napoleon vordringen konnte, wurde man auf den sich auffällig durch die Menge vorwärts Drängenden aufmerksam und nahm den mit einem langen Messer Bewaffneten fest, bevor er sein Vorhaben ausführen konnte. Als er Napoleon vorgeführt wurde, fragte ihn dieser in großmütiger Laune:
„Wenn ich Sie nun begnadige, wie werden Sie es mir danken?“
Unbeirrt, den sicheren Tod vor Augen, antwortete der Siebzehnjährige:
„Ich werde darum nicht minder Sie töten.“
Vier Tage später wurde er hingerichtet.
Schon fünf Tage nach seiner Ankunft erhielt Christoph einen ungewöhnlichen, seiner eigentlichen Aufgabe als Wundarzt nicht entsprechenden Auftrag.
Er sollte einen von plötzlicher Geistes- und Gemütsstörung befallenen Oberleutnant der Kavallerie namens Eduard von Miller zu seiner Familie nach Ludwigsburg begleiten. Emil, der jüngere Bruder des Kranken, Leutnant der königlichen Leibjäger, war eigens für dessen Transport in einem bequemen Reisewagen aus Stuttgart gekommen.
Zu dritt brachen sie am Morgen auf und fuhren die Christoph schon bekannte Strecke in Richtung Sankt Pölten. Schon bald erreichten sie Purkersdorf, wo der Leutnant einen dort einquartierten befreundeten Offizier besuchen wollte. Da der Besuch nur kurz dauern sollte, blieb der Kranke mit Christoph allein im Wagen zurück.
Wortlos saßen sich beide gegenüber. Schon zu Beginn der Fahrt war Eduard von Miller Christoph feindselig begegnet. Daran hatte auch nichts geändert, dass Christoph ihn an ihre gemeinsame Schulzeit in Ludwigsburg erinnerte, während der sie Freunde waren und Christoph ihn dort in seinem Elternhaus oft besuchte. Entweder hatte er das in seiner derzeitigen Verwirrtheit vergessen oder es war für ihn jetzt bedeutungslos.
Ganz plötzlich hielt Christophs Gegenüber eine Pistole in der Hand, die sein Bruder unbedacht in einer Seitentasche des Wagens zurückgelassen hatte. Mit hasserfülltem Blick zielte der Verwirrte auf Christophs Gesicht, dann auf seine Brust, dann wieder aufs Gesicht, abwechselnd mit gespanntem und gesichertem Hahn.
Der Gefahr bewusst, in der er schwebte, zwang sich Christoph dazu, keine Furcht zu zeigen und blickte Eduard ruhig und fest in die unstet flackernden Augen, bis dieser nach endlos scheinenden Sekunden den Blick senkte und kraftlos den Arm mit der Waffe sinken ließ.
Kurz darauf kam Emil von Miller zurück und erschrak heftig, als er die geladene Pistole in der Hand seines Bruders erblickte. Hastig entriss er ihm die Waffe.
„Tut mir schrecklich leid, Christoph.“ stieß er hervor. „Wie konnte ich nur so unvorsichtig sein. Ich darf mir gar nicht vorstellen, was hätte geschehen können. Verzeih!“
„Ist ja noch einmal gut gegangen.“, beschwichtigte Christoph.
Den Rest der Fahrt sprachen sie wenig miteinander. Eduard starrte schweigend auf den Wagenboden.
Am Abend kamen sie müde und hungrig in Sankt Pölten an, stiegen in einem Gasthof ab, bestellten eine einfache Mahlzeit und begaben sich bald nach dem Essen auf ihre Zimmer.
Groß war die Freude, als Christoph am nächsten Morgen vor der Weiterfahrt die Familie Prell aufsuchte. Obwohl er sich erst vor einer Woche verabschiedet hatte, empfing man ihn, als ob er lange Zeit fort gewesen wäre. Besonders die Kinder freuten sich über seine frühe Rückkehr.
„Christoph! Christoph! Bleibst du jetzt bei uns? Bleib doch bei uns! Bitte!“
„Das geht leider nicht.“, lachte Christoph. „Ich muss einen wichtigen Auftrag erledigen.“
Als er die enttäuschten Gesichter der Kinder sah, fügte er schnell hinzu:
Читать дальше