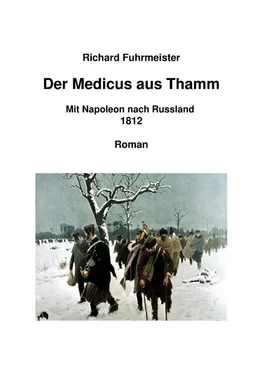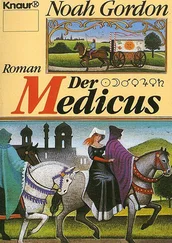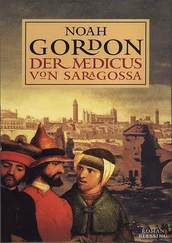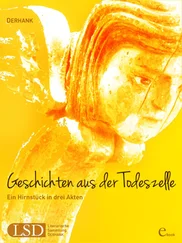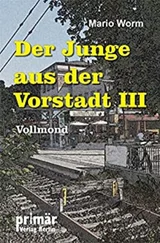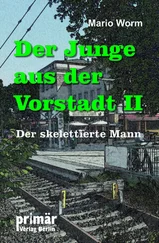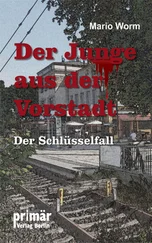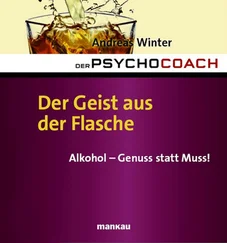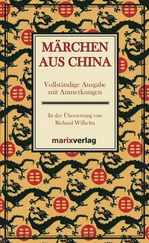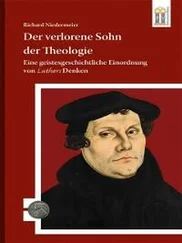„Groß, ich gratuliere Ihnen.“, lobte Baur nach dem erfolgreichen Verlauf der Exartikulation. „Ich hätte es nicht besser machen können.“
Nach kurzer Pause fuhr er fort, wobei sein Gesicht einen ernsten Ausdruck annahm:
„Wissen Sie, Groß, es klingt sicher sonderbar, aber ich führe, obwohl ich kein Wundarzt bin, lieber eine Amputation durch, als dass ich einen Bauch- oder Brustschuss behandeln muss. Da sind wir Ärzte doch fast immer machtlos und müssen hinnehmen, dass der Getroffene stirbt, weil wir ihm nicht helfen können. Oder anders gesagt: Ein Schuss in den Brustkorb oder in die Bauchhöhle ist fast immer ein Todesurteil.“
Christoph stimmte ihm zu. Oft hatte er erlebt, wie derart Verletzte qualvoll starben, weil die Bleikugel zu tief in Bauch oder Brust eingedrungen war und nicht entfernt werden konnte. Wenn der Getroffene Glück hatte, gelang es dem Wundarzt, die Kugel oder den Kartätschensplitter mit einer Greifzange zu packen und herauszuziehen. Aber selbst das garantierte nicht das Überleben. Häufig starb der scheinbar Gerettete kurz darauf an einer Wundinfektion, besonders dann, wenn der Arzt mit bloßen Fingern das Geschoss entfernt hatte, was zuweilen vorkam. Bei einer größeren Wunde gab es meist keine Rettung mehr.
Womit Christoph sich nicht anfreunden konnte, war die schon seit dem Altertum angewandte Moxa oder Moxibustion, derer sich Larrey gern bediente. Er zweifelte nicht nur an der Wirksamkeit dieser Methode, ihm missfiel auch, dass nach dem langsamen Abbrennen von Beifußkraut oder Baumwolle über einer Wunde nach ihrer Verheilung oft Brandnarben entstanden.
***
Unauslöschlich brannte sich in Christophs Erinnerung das Bild ein, das sich ihm bot, als er Anfang Mai spätabends mit seinem Bataillon auf dem Weg nach Linz durch Ebelsberg an der Traun zog. Nach erbitterten Kämpfen, in denen die Franzosen die Österreicher einmal mehr geschlagen hatten, war der Ort fast völlig zerstört. Die meisten Gebäude waren niedergebrannt, ihre Reste glühten in der Dunkelheit, manche standen noch in Flammen. Dies allein schon war ein gespenstischer Anblick, was Christoph und seine Begleiter aber dann erblickten, überstieg alles, was sie bisher an Schrecklichem gesehen hatten. Überall in den Straßen, besonders in der Hauptstraße, aber auch auf der hölzernen, weit über das Flussufer hinausreichenden Traunbrücke lagen Leichen, viele halb verbrannt, manche bereits verkohlt und selbst von Soldaten derselben Einheit nicht mehr wiederzuerkennen. Unerträglich lag der Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft. Christoph hatte in den beiden Feldzügen, die hinter ihm lagen, auf den Schlachtfeldern schon viele Tote gesehen, aber selten in diesem Zustand. Besonders die sehr jungen, an die Schrecken des Krieges nicht gewöhnten Soldaten stiegen verstört und mit verzerrten Gesichtern über die Leichen hinweg oder gingen, gegen die aufkommende Übelkeit ankämpfend, um sie herum.
Als sie die Hauptstraße durchritten, hörten Christoph und der neben ihm reitende Major von Röder aus einem angrenzenden Garten ständig an- und abschwellende Klagelaute und Stöhnen.
Der Major nickte Christoph zu:
„Groß, kümmern Sie sich um den Blessierten! Ich reite weiter. Wir sehen uns später.“
Christoph überließ sein Pferd einem Pfleger mit der Bitte, es dem Bataillon zuzuführen und zu versorgen. Er werde es dort später wieder abholen. Er selbst werde mit einem der Maroden- oder Bagagewagen nachkommen, sobald er den Verwundeten behandelt habe.
Gemeinsam mit einem Unterarzt eilte Christoph in den durch die Flammen erleuchteten Garten, aus dem die Schmerzenslaute kamen. Inmitten von Toten und nur noch leise stöhnenden oder röchelnden Sterbenden lag kopfabwärts an einem abschüssigen Wiesenrain ein noch sehr junger Freiwilliger der österreichischen Infanterie. Eine Kanonenkugel hatte ihm beide Beine zerschmettert.
Sofort war Christoph klar, dass er hier nicht mehr helfen konnte. Aber er wollte dem Sterbenden wenigstens die kurze, ihm noch verbleibende Zeit erleichtern, indem er ihm von dem mitgeführten Opium verabreichen und ihn in eine bequemere Lage bringen würde.
Christophs Vorhaben erkennend, bat der Sterbende mit aller ihm noch verfügbaren Entschiedenheit, ihn nicht zu berühren und ihn hier liegen zu lassen.
„Ich brauche keine Hilfe mehr. Lasst mich in Ruhe sterben!“
So sehr die beiden in ihn drangen, er lehnte jede Hilfe, jede Erleichterung ab und ersehnte nur noch den baldigen Tod, so dass den Zurückgewiesenen nichts anderes übrig blieb, als ihm seinen Wunsch zu erfüllen.
***
Untragbare Zustände herrschten in den überfüllten Hospitälern. Eines davon hatten die Franzosen in Sankt Pölten, wohin Christoph beordert wurde, in der weiträumigen Klosteranlage eingerichtet. Zeitweise lagen dort bis zu achthundert Verwundete und Kranke, die auf Rettung hofften. Was Amputationen, Verletzungen und Wundbrand nicht schafften, erledigte das typhöse Fieber, dem selbst die Mehrzahl der behandelnden Ärzte zum Opfer fiel. Einer nach dem anderen wurde vom Typhus dahingerafft.
Der für Sankt Pölten und somit auch für das Hospital zuständige französische Befehlshaber bestimmte deshalb Christoph zu dessen Leiter mit der Zusage, dass ihn bald ein französischer Arzt ablösen würde.
An der baldigen Ablösung zweifelnd, gehorchte Christoph nur widerwillig dem Befehl, der ihn von seinem weiterziehenden Regiment und seinen württembergischen Landsleuten trennte. Dennoch versah er seinen Dienst mit aller Sorgfalt und der unablässigen Bereitschaft zu helfen.
Da das Hospital überbelegt und nicht viel Zeit zu dessen Einrichtung geblieben war, konnte es den Vorschriften, die die Ausstattung eines französischen Militärhospitals regelten, nur unzureichend genügen. Die Bestimmungen schrieben vor, dass die Krankenbetten so aufgestellt sein mussten, dass man um sie herumgehen konnte und sie Ärzten und Pflegern von allen Seiten zugänglich waren. Jedem Kranken stand ein Bett aus einem Strohsack zu, ferner eine mit Zwillich überzogene Wollmatratze, zwei Betttücher, die alle vierzehn Tage, bei Verschmutzung aber sofort gewechselt wurden, eine wollene Decke und ein Wollkissen. Bei seiner Einlieferung sollte der Verwundete oder Kranke leinene Pantalons und ein weißes Hemd, die beide wöchentlich ausgetauscht wurden, eine Mütze und einen grauen Mantel erhalten. Zusätzlich sollten ihm ein Becher und eine Schüssel, jeweils aus Zinn, ein Krug für die Tisane, den Kräuter- oder Früchtetee, ausgehändigt werden. Alle Gefäße waren von den Krankenwärtern täglich gründlich zu reinigen. Verstöße wurden mit Arrest bestraft. Den Wärtern war es bei Strafe verboten, den Kranken für Geld etwas zu essen oder zu trinken zu besorgen, sofern der Arzt es nicht bewilligt hatte. Patienten mit der gleichen Krankheit wurden gewöhnlich zusammen in denselben Saal oder Raum gelegt. Um Ansteckungen zu vermeiden, durften sie nicht von einem in den anderen Raum gehen.
In einer noch vom französischen Nationalkonvent verfassten Instruktion für die Krankenwärter, die Christoph als sehr übertrieben betrachtete, hieß es, „dass kein Krankenwärter sich unterstehen solle, einen Priester zu einem Kranken zu lassen, denn da, wo man die Menschheit pflege, müsse der Fanatismus sich nicht einschleichen. Dieser mache schon Gesunde krank und gewiss Kranke noch kränker.“
Andererseits gab es auch die Anweisung, der Christoph voll zustimmte, „durchaus keinen Unterschied der Personen zu machen, für Fremde ebensogut wie für Franzosen zu sorgen und jedem Hilfsbedürftigen nach Vermögen zu dienen.“
All diese Vorschriften, Bestimmungen und Verbote mochten gut gemeint sein, ließen sich aber im Ernstfall wie hier in Sankt Pölten oft nur ungenügend durchsetzen.
Das Christoph in Sankt Pölten unterstellte geringe Personal bestand nur aus ein paar Hilfschirurgen, einem Apotheker und zumeist aus Rekonvaleszenten, die man ohne allzu große Rücksicht auf den Grad ihrer Genesung als Krankenwärter verpflichtet hatte. Jeden Morgen wurde Christoph vom Oberkrankenwärter, einem baumlangen, ehemaligen Schmied aus der Auvergne, mit einem gebrummten „Bonjour monsieur!“ begrüßt, worauf er die ständig wachsende Zahl der über Nacht Gestorbenen hinzufügte:
Читать дальше