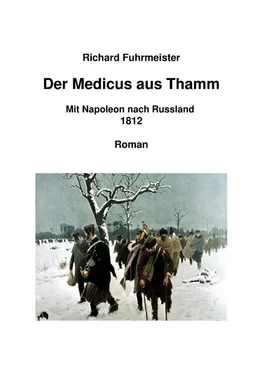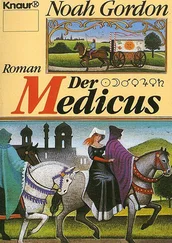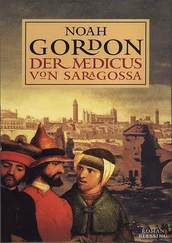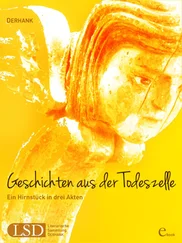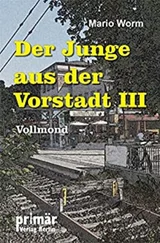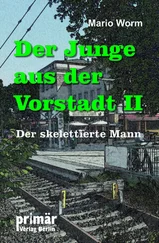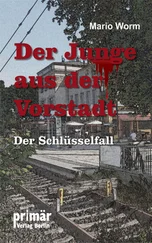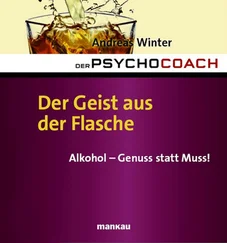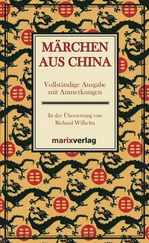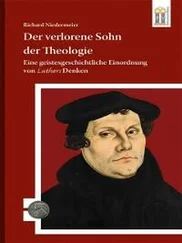Wie auf Befehl ertönte aus allen Kehlen einstimmig der Ruf:
„Vive l'empereur!
Nachdem Napoleon die gebildete Gasse durchritten hatte, rief er:
„Le chirurgien-major!“
Regimentsarzt Baur eilte herbei. Mit stark französischem Akzent fragte ihn der Kaiser:
„Haben Sie Gehülf? Genug Bandage?“
„Ja, Sire!“, erwiderte Baur schnell.
Kaum hatte er die Antwort vernommen, galoppierte Napoleon los, dem Gefecht entgegen.
Christophs Regiment rückte vor, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Die Österreicher hatten bereits die Flucht angetreten. Verwundete waren nur wenige zu versorgen.
***
Auf seinem Marsch nach Wien, das er noch früher als von ihm vorhergesagt erreichte, reihte der Franzosenkaiser Sieg an Sieg: Landshut, Eggmühl, Regensburg, Ebelsberg und zuletzt Wagram, das für Österreich die endgültige Niederlage brachte. Einzige und für den siegverwöhnten Feldherrn enttäuschende Ausnahme bildete die Schlacht bei Aspern, die seinen Nimbus als unbesiegbarer Stratege erstmals erschütterte und in Europa kurzzeitig Hoffnung auf den Sturz des Usurpators aufkeimen ließ.
Auch für Christoph wäre dies das Ende der immer wiederkehrenden Unterbrechungen seines Studiums gewesen. Ein baldiger Studienabschluss hätte vor allem eine frühere Heirat mit Klara bedeutet. Aber der Sieg bei Wagram zerstörte allerorten die Zuversicht auf das Ende der französischen Vorherrschaft auf dem Kontinent.
Anders als bei Abensberg gab es beim Vorrücken auf Wien nach heftigen, blutigen Gefechten zahlreiche Tote und Verwundete auf beiden Seiten. Christoph und seine Helfer arbeiteten unermüdlich bis zur Erschöpfung. Gliedmaßen mussten amputiert, Blutungen gestillt, Verbände angelegt, Brüche geschient, Gewehr- oder Kartätschenkugeln entfernt werden, soweit sie nicht zu große oder tiefe Wunden gerissen hatten, die eine Amputation unvermeidlich machten.
Dass Christoph inzwischen den Anforderungen eines Feldarztes gewachsen war, verdankte er nicht zuletzt seinem Vorgesetzten, Regimentsarzt Baur, dem er schon bei seinem ersten Feldzug 1805 zugeteilt worden war und der ihn, den noch Unerfahrenen, fast väterlich betreut hatte. Wie Adam Groß bei seinem heranwachsenden Sohn schon früh die besonnene Art und das handwerkliche Geschick bei der Wundversorgung und anderen medizinischen Verrichtungen festgestellt hatte, so erkannte auch Baur Christophs Fähigkeiten und förderte ihn, so gut er nur konnte. Unter seiner Anleitung erwarb sich Christoph Kenntnisse und praktische Erfahrungen, die ihm in der Folgezeit von großem Nutzen waren. Baur, ein hochgewachsener, kräftiger Mann mit energischen Gesichtszügen, war bereits damals ein Bewunderer Larreys. Ein einziges Mal nur war er Zeuge von dessen Geschicklichkeit geworden, als er einer Beinamputation, genauer einer Exartikulation im Hüftgelenk beiwohnte, bei welcher Larrey seine besondere Technik anwandte, das entsprechende Glied mit dem Skalpell im Gelenk abzutrennen und es nicht an einer willkürlich gewählten Stelle abzusägen. Baur war so sehr von Larreys Vorgehen beeindruckt und von deren Richtigkeit überzeugt, dass er sie bald darauf einige Male selbst anwandte, obwohl Amputationen den Wundärzten vorbehalten waren und nicht zu seinem Aufgabenbereich zählten. Er hatte es des Öfteren erleben müssen, dass während einer Schlacht unaufschiebbare Amputationen nicht durchgeführt werden konnten, weil die Chirurgen selbst verwundet oder getötet worden waren. Das hatte in ihm den Wunsch geweckt, selbst zu amputieren, um Verwundete zu retten, die andernfalls sterben würden. Er bat seinen Regimentskommandeur um die Erlaubnis, die Larreysche Methode zuerst an gefallenen Soldaten zu erproben, um sie dann auf dem Schlachtfeld oder im Hospital an Schwerverwundeten durchzuführen.
Nachdem Baur seine Fertigkeit an Toten vervollkommnet und mehrmals bei Amputationen durch erfahrene Wundärzte assistiert hatte, die ebenfalls Larreys Verfahren der Exartikulation anwandten, wagte er sich selbst an diese Technik bei Verwundeten heran. Bei einer dieser Amputationen bat er Christoph, ihm zur Hand zu gehen, der bereitwillig dem Wunsch des von ihm bewunderten Vorgesetzten folgte. Einem noch sehr jungen Soldaten der Linieninfanterie hatte eine Kartätschenladung den linken Arm bis eine Handbreit unter der Schulter zerschmettert. Um den Schwerverwundeten zu retten, der in ein nahes Behelfshospital gebracht worden war, blieb nur die schnelle Exartikulation im Schultergelenk.
Obwohl der Verletzte sich erstaunlich ruhig verhielt und nur vereinzelt stöhnte, gab ihm Baur vor der Amputation etwas Opium.
„Er wird es brauchen und dafür dankbar sein.“, sagte Baur halblaut zu Christoph. „Es wird für ihn und für uns leichter sein. Wenn wir nicht hier im Hospital wären, würde ich ihn nicht betäuben.“
Der Einsatz von Narkosemitteln aus Opium, Bilsenkraut oder Alraune war zwar möglich, aber deren Wirkung schwer zu kontrollieren, so dass bei Amputationen oder anderen schmerzhaften Behandlungen auf dem Schlachtfeld meistens darauf verzichtet wurde. Solange der Verwundete schrie, wusste der Arzt oder Chirurg, dass dieser noch bei Bewusstsein war und um sein Leben kämpfte.
Zwei Helfer legten den Verwundeten auf einen langen Holztisch, von dem ein weiterer Helfer eilig die Blutreste der vorangegangenen Amputation weggewischt hatte, und brachten ihn in eine für den Eingriff vorteilhafte Position. Dann begann Baur mit einem längs geführten Schnitt vom oberen Teil des Schulterknochens abwärts. Dabei zerlegte er die Fasern des Deltamuskels in zwei gleiche Teile.
Der junge, nur leicht betäubte Infanterist hatte den Kopf zur Seite gewandt, so dass er den Vorgang nicht mitansehen musste. Er zuckte kurz und stöhnte leise, als Baur mit dem Skalpell seinen ersten Schnitt durchführte.
„Ziehen Sie jetzt die Haut ganz nach oben!“ sagte Baur zu Christoph, der ihm aufmerksam zusah und seiner Aufforderung schnell nachkam.
Durch zwei weitere Schnitte entstanden ein vorderer und hinterer Lappen, wobei die beiden Sehnen des großen Brustmuskels und des Rückenmuskels einbezogen wurden. Dann schnitt Baur die Anhängsel beider Lappen weg und hieß Christoph die durchtrennten Kranzarterien des Schultergelenks zusammenzudrücken, das nun völlig freigelegt war. Durch einen weiteren Schnitt um den Oberarmkopf trennte Baur das Kapselband und die hier ansetzenden Sehnen, dann die am hinteren Teil des Oberarmkopfs liegenden Sehnen und Bänder ab. Anschließend durchschnitt er das ganze Bündel der Achselgefäße ohne jeglichen Blutverlust. Mit einer Pinzette erfasste er das Ende der Achselschlagader und unterband sie ebenso wie die Kranzarterien.
Die Operation war beendet, der Arm vollständig amputiert. Christophs Aufgabe war es, die Wunde zu reinigen, die beiden Fleischlappen einander anzunähern und sie mit Heftpflastern zusammenzuhalten. Darüber legte er ein Stück feine, vorher in warmen Wein getauchte Leinwand, darauf etwas Werg und eine längliche Kompresse. Den Abschluss bildete eine Bandage.
Der derart Behandelte hatte während der ganzen, in kürzester Zeit durchgeführten Operation kaum einen Schmerzenslaut von sich gegeben. Er war erstaunt, dass, wovor er sich gefürchtet hatte, so schnell gegangen war. Dass ihm ein Arm fehlte und nun ein Leben als Krüppel vor ihm lag, war ihm noch nicht klar und würde ihm erst nach und nach bewusst werden. Im Augenblick war er nur froh, gerettet worden zu sein und fast keine Schmerzen zu empfinden.
Schon einige Tage später hatte Christoph Gelegenheit, unter Baurs aufmerksamer Beobachtung und Assistenz den gleichen Eingriff selbst durchzuführen. Er wollte Baurs Beispiel folgen und Amputationen durchführen, wenn kein Wundarzt zur Verfügung stand. Wie Baur auch, den er als seinen Mentor betrachtete, hatte er im Studium die erforderlichen anatomischen Kenntnisse erworben und beim Sezieren praktische Erfahrungen gesammelt. Sehr zustatten kam ihm außerdem, dass er seinen Vater oft zu Besuchen von Kranken oder Verletzten begleitet und ihm bei deren Behandlung, darunter auch Amputationen, assistiert hatte.
Читать дальше