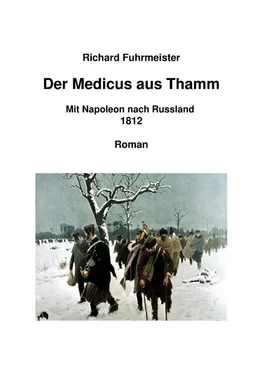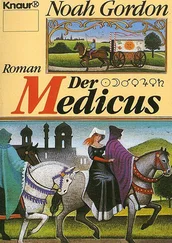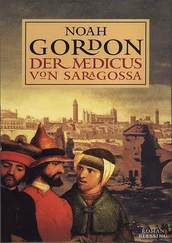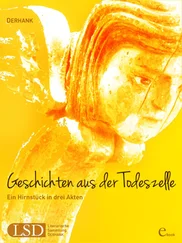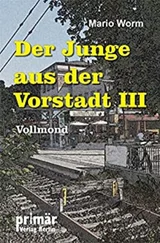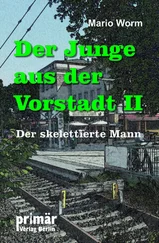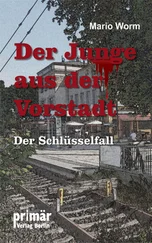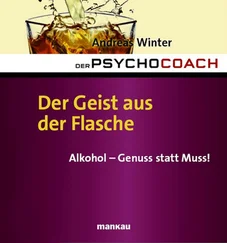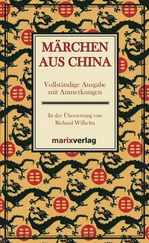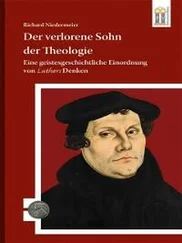„Dix sont morts.“ oder „Douze sont morts.“, sagte er fast teilnahmslos.
Einige Male erlitt Christoph einen Anfall von Schwäche, fiel sogar in eine kurze Ohnmacht, aber vom Typhus blieb er verschont. Er führte das darauf zurück, dass er vor drei Jahren in Neckarbischofsheim, wo ihn Klara so liebevoll gepflegt hatte, an Typhus erkrankt war und deshalb gegen einen erneuten Ausbruch der Krankheit gefeit schien.
Wenn ihn jetzt im Hospital Erschöpfung und Kraftlosigkeit überkamen und ihn die Angst befiel, sich doch angesteckt zu haben, eilte er zu einem der Fenster, öffnete es und atmete ein paarmal tief durch. Zusätzlich trank er von der stets vorrätigen potion cordiale , einer Pomeranzenschalentinktur gemischt mit rotem Wein und Zucker.
Bei den Schwerkranken halfen solche einfachen Mittel nicht. Über Weiterleben oder Sterben entschied letztlich die körperliche Verfassung, in der sich der Kranke vor seiner Verwundung oder Ansteckung befunden hatte. Wer von robuster Natur war, hatte gewöhnlich bessere Aussichten zu überleben. Das sich unaufhaltsam ausbreitende bösartige Hospitalfieber oder, wie Christoph im Studium gelernt hatte, der Typhus con tagiosus nosocomialis begann mit ansteigendem Fieber, starken Kopfschmerzen und Schüttelfrost. Bei den Verletzten, die im Hospital die größte Gruppe bildeten, kam zum Typhus der Hospitalbrand dazu, bei dem der entstandene Eiter aschgrau, dick und klebrig wurde und Ekel erregend roch. Die Wundränder schwollen an und färbten sich schwarz. Die Kopfschmerzen verstärkten sich, der Herzschlag wurde schneller und unregelmäßig. Heftige Oberbauchschmerzen, Koliken und Erbrechen, völlige Harnverhaltung, vermehrter Stuhlabgang mit schwärzlichem Blut und Nasenbluten folgten. Der Kranke verlor das Bewusstsein. Wenn er, wieder erwacht, sich bewegte, geschah es ruckartig wie bei einer Marionette. Die Gesichtszüge waren entstellt. Immer öfter setzte der Puls aus. Im weiteren Verlauf schlug die Verwirrtheit des Kranken in Raserei um und es traten Schüttelkrämpfe am ganzen Körper auf. Im letzten Stadium schwoll der Leib auf, die inneren Krämpfe steigerten sich ins Unerträgliche. In völliger geistiger Verwirrung verfiel der Patient, dessen brandige Wunden einen weithin wahrnehmbaren üblen Geruch verbreiteten, schließlich in einen Zustand äußerster körperlicher Schwäche und wurde nach fünf bis sieben, selten nach neun Tagen von seinem Leiden erlöst.
***
Christophs Zweifel an einer baldigen Ablösung durch einen französischen Arzt bestätigten sich. Erst nach vier Wochen erschien im Sankt Pöltener Militärhospital ein älterer Chirurgien , der ihn von seiner schweren, kräftezehrenden Aufgabe entband.
Während seines Aufenthalts in Sankt Pölten wohnte Christoph wie zwei Jahre zuvor in Neckarbischofsheim bei einer Kaufmannsfamilie, die den jungen Gast freundlich wie einen Landsmann aufnahm und ihn nie spüren ließ, dass er bei ihr zwangseinquartiert war und einer feindlichen Invasionsarmee angehörte.
„Wir sprechen doch die gleiche Sprache und ihr Württemberger wurdet doch wie die Bayern und andere nur gezwungen, mit dem Franzosenkaiser in den Krieg zu ziehen.“, meinte einmal Kaufmann Prell, dessen rundliche Gestalt sein gemütliches, stets freundliches Wesen unterstrich. Für etwaige gedankliche Verbindungen seines Namens zu seinem Beruf gab es keinen Anlass, fand Christoph.
„Das ist wahr.“, erwiderte Christoph erleichtert und froh, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Es war ihm oft, besonders in den ersten Tagen seiner Einquartierung, unangenehm, in eine ihm fremde Familie einzudringen, mit ihr bei der Abendmahlzeit am selben Tisch zu sitzen, zu essen und zu trinken, was er nicht bezahlt hatte. Eigens für ihn hatte man die Kammer der Dienstmagd, die seinetwegen in der Küche auf einer Pritsche schlafen musste, wohnlich hergerichtet.
Wenn Christoph abends müde und erschöpft aus dem Hospital kam, bot ihm der Hausherr oder seine Frau ein Glas Wein an und fragte mitfühlend, wie sein Tag und die Arbeit im Hospital gewesen seien.
Auch die Kinder, zwei Mädchen, zehn und neun Jahre alt, und ihr sechsjähriger Bruder hatten Christoph bald ins Herz geschlossen. Im Umgang mit jüngeren Geschwistern erfahren, beantwortete er geduldig ihre nicht endenden Fragen.
„Christoph“, er hatte ihnen diese Anrede erlaubt, obwohl ihre Eltern sie deshalb rügten, „sind heute wieder Leute gestorben? Hast du wieder operiert? Hast du ein Bein oder einen Arm abgeschnitten?“
„Das heißt nicht abgeschnitten, sondern amputiert.“, verbesserte dann die Mutter, eine energische, kräftige Frau Mitte dreißig, deren lange, hinten zusammengeknotete schwarze Haare schon ein paar graue Strähnen durchzogen.
Als Christoph die Order erhielt, sein Regiment in Wien aufzusuchen, hatte er beim Abschied nicht den Eindruck, dass seine Wirtsleute und die Kinder sich über seine Abreise freuten.
„Sie müssen uns auf jeden Fall besuchen, falls Sie auf dem Rückmarsch von Wien wieder hier durchkommen. Sie sind uns immer willkommen.“, versicherte seine Gastgeberin.
„Das werde ich bestimmt tun.“, entgegnete Christoph gerührt.
Der französische Ortskommandant wollte Christoph aus Dankbarkeit und Anerkennung für seinen mehrwöchigen Einsatz im Hospital einen Einspänner für die Reise nach Wien zur Verfügung stellen. Doch Prell bestand darauf, ihn selbst in seinem eigenen Gefährt dorthin zu fahren.
Christoph hatte sich schon einige Male gefragt, was wohl der Grund für die herzliche Aufnahme durch Prell und seine Familie sein mochte. Auch jetzt nach Prells großzügigem Angebot, ihn nach Wien zu bringen, stellte er sich erneut diese Frage und fand nur eine Erklärung: Prell hatte einmal erwähnt, dass er einen jüngeren Bruder, Joseph mit Namen, gehabt habe, der mit neunzehn Jahren an Diphtherie gestorben sei. Und diesem Bruder, den er sehr geliebt habe, sehe Christoph ähnlich. Auch in seinen Bewegungen, selbst in der Stimme ähnele er Joseph.
Nach zwölfstündiger Fahrt erreichten sie die südlich von Wien gelegene Ortschaft Oberdöbling, wo Christophs Regiment seit einigen Wochen kampierte, während das Gros der napoleonischen Streitmacht östlich der Hauptstadt auf dem Marchfeld lagerte.
Christoph meldete sich bei seinem Vorgesetzten und bat ihn, erst am nächsten Morgen seinen Dienst antreten zu dürfen, was dieser sofort erlaubte. So stimmte Christoph Prells Vorschlag zu, mit ihm nach Wien hinein zu fahren, dort in einem Gasthof zu speisen und zu übernachten.
Schon während der langen Fahrt von Sankt Pölten nach Wien hatte Prell Christoph angeboten, ihm eine größere Summe Geld zu leihen, weil dieser, von seinem Regiment getrennt, seit Längerem keinen Sold erhalten hatte.
Prell sprach von mehreren hundert Gulden, die Christoph ruhig annehmen könne.
„Aber ich weiß doch gar nicht, ob und wann ich sie Ihnen zurückzahlen kann.“, wandte Christoph ein.
Der Kaufmann ließ nicht locker und Christoph nahm schließlich einhundert Gulden von ihm an. Als er dafür eine Quittung ausstellen wollte, wies Prell das entschieden zurück und bemerkte in der nüchternen Art eines Kaufmanns:
„Wenn Sie am Leben bleiben, so bekomme ich das Geld gewiss wieder zurück. Wenn nicht, so würde ich mich stets freudig daran erinnern, Ihnen ausgeholfen zu haben.“
Ganz in der Nähe der Hofburg stiegen sie in einem einfachen, aber sauberen Gasthof ab, in dem Prell schon bei früheren Wienbesuchen übernachtet hatte und deshalb vom Wirt aufs Freundlichste begrüßt wurde. Nicht ganz so freundlich, aber doch nicht abweisend hieß er auch Christoph, an seiner Uniform sofort als Besatzer zu erkennen, willkommen.
„Die Herren haben Glück. Ein Zimmer ist noch frei. Macht es Ihnen etwas aus, sich das Zimmer zu teilen?“ fragte im weichen, melodischen Wiener Tonfall der Wirt, dessen gerötete Nase verriet, dass er den Getränken, die er seinen Gästen servierte, ebenfalls zusprach.
Читать дальше