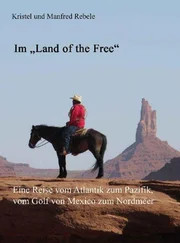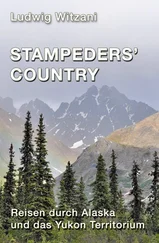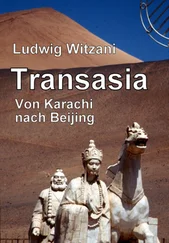Denn wenn man sich der Stadt von Osten näherte, vorbei an den Squattersiedlungen und Townships im Umkreis des Flughafens, dann verschwanden Schönheit und Wohlgestalt wie weggeblasen. „Er ist nicht einmal drei Monate fortgewesen“, ließ der südafrikanische Nobelpreisträger J.M. Coetze dseinen Protagonisten David Lurie in dem Roman „Schande“ sinnieren, „doch während diese Zeit waren die Elendsviertel über die Autostraße hinweg gewachsen und hatten sich östlich vom Flughafen ausgebreitet.“ Das war nun auch schon einige Jahre her, und längst hatten sich die Townships noch näher an Flughafen und Peripherie herangearbeitet Überall an den Straßenrändern standen Männer, Frauen, Jugendliche und suchten nach einer Mitfahrgelegenheit in die Stadt, weil der öffentliche Nahverkehr nicht funktionierte. Zigtausende fuhren aus den Cap Flats alltäglich in die Stadt zur Arbeit, hinein in das Zentrum der glänzenden Metropole, um sie am Abend wieder zu verlassen, um in die Tristesse ihrer Blechhütten zurückzukehren.
Eine Generation nach dem großen Wandel am Kap hatte sich die Situation der schwarzafrikanischen Mehrheitsbevölkerung nicht entschieden verbessert. All die Mittel, die für Elektrifizierung der Townships und Vorstädte, für Abwasserkanäle, Schulen, Krankenhäuser und Verkehrsverbindungen ausgegeben worden waren, hatten den Lebensstandard nicht angehoben. Mit dem explosionsartigen Wachstum der schwarzafrikanischen Bevölkerung hielt die Ausweitung des öffentlichen Wohlfahrts- und Infrastruktursektors einfach nicht mit. Das Land stöhnte unter überbordender Kriminalität, exzessivem Alkoholismus und Drogenmissbrauch - nicht überall sichtbar, aber an den Rändern der großen Städte schmerzhaft präsent. Die Zeitungen waren voll von Berichten über „Tik“, eine leicht herzustellende Massendroge auf Amphetaminbasis, die persönlichkeitsverändernd wirkte und die sozialen Beziehungen zerstörte. Längst war der ANC, der African National Congress, der vor einer Generation den Wandel am Kap erkämpft hatte, in Inkompetenz und Korruption erstarrt. Auf Nelson Mandela, die Lichtgestalt des späten 20. Jahrhunderts, war Präsident Zuma gefolgt, ein Vergewaltiger und Schieber, der nur durch die noch leidlich funktionierenden Institutionen der Gewaltenteilung an der Aufrichtung einer Diktatur gehindert wurde.
Dann wieder ganz andere Bilder im Zentrum von Kapstadt, so krass und unvermittelt, als hätte man das Fernsehprogramm gewechselt. Die bunten Straßenszenen an der St. Georges Mall, die einladenden Restaurants an der Waterfront und die herausgeputzten Fassaden des Bo-Kaap-Viertels befanden sich ein Universum entfernt von den überfüllten Townships, die ich gerade erst passiert hatte. Kapstadts urbanes Zentrum präsentierte sich wie eine Prosperitätszone aus einem anderen Kontinent, eine Region der Reichen und Etablieren, die in ihren Premium-Limousinen vor Markengeschäften parkten, in denen die gleiche Mode verkauft wurde wie in London oder New York. Große Bürokomplexe beherbergten die Firmenzentralen internationaler Konzerne, die die immensen Bodenschätze vermarkteten, die Südafrika noch immer zum wirtschaftlich stärksten Land Afrikas machten.
Erst auf den zweiten Blick wurde eine Doppelbödigkeit sichtbar, die mir auf meiner Reise durch Südafrika noch oft begegnen sollte. In einem Hauseingang lag ein schwarzafrikanischer Obdachloser, betrunken oder vom Rauschgift benebelt. Bettler saßen vor den Eingängen der Kaufhäuser, und in den Seitenstraßen türmten sich die ersten Müllhaufen - wohlgemerkt, alles nicht so aufdringlich und bildfüllend wie in Daressalam oder Lusaka, aber unverkennbar gegenwärtig als Indiz dafür, dass auch diese Stadt der Ersten Welt von den Armeen der Armut bedroht wurde. Noch fuhren die Weißen in stattlichen Limousinen durch die Stadt, während ihnen die schwarzen Dienstleister die Parkplätze freihielten, aber die Zahl der bettelnden Kinder, die wie ausgemergelte kleine Trolle vorbeihuschten, nahm zu. So schnell konnte die Polizei sie gar nicht wegschaffen, dass die Touristen ihre Auftritte nicht bemerken würden.
Beim Abendessen im Hotelrestaurant hoch über der Stadt saßen zwei Touristen aus England am Nebentisch, beide waren leger gekleidet, einer trug eine Kappe auf dem Kopf. Ein Kellner trat an den Gast heran und bat ihn, die Kappe abzunehmen, was den Gast offenbar erstaunte, ehe er nach kurzem Zögern dem Wunsch nachkam. Die Pointe dieser Szene bestand darin, dass der Restaurantangestellte, der den Gast aufgefordert hatte, seine Kappe abzunehmen, ein Schwarzer war und der Gast weiß. Ich blickte mich um und sah, dass alle Kellner schwarz waren und die Gäste weiß. Nur eine indische Familie, Mutter Vater, zwei Töchter, saßen an einem Fenstertisch, alle akkurat gekleidet und ersichtlich darauf bedacht, die Formen zu wahren.
Eine Metapher von Peter L. Berger fiel mir ein, der in der globalisierten Welt zwei Kategorien von Menschen unterschied: die „Wahlschweden“ und die „Wahlperser“. Die „Wahlschweden“ lebten in der belle Etage , ihr Alltag und ihre Fortbewegung vollzogen sich einfach und unkompliziert, weil in der Parterre die „Wahlperser“ die Dienstleistungen und Kärrnerarbeiten ausführten
In der Nacht fielen Schüsse. Dann hörte ich Geschrei auf den Straßen, schließlich die Sirene eines Polizeiwagens. Am Morgen wurde berichtet, dass sich vor dem Hotel ein Überfall ereignet hatte. Ein japanisches Paar war von einem Jugendlichen mit einer Pistole bedroht worden. Als die Angegriffenen fliehen wollten, hatte der Räuber geschossen, sein Ziel aber verfehlt. Dann war er verschwunden, die Polizei fahndete nach ihm.
„Ist das normal hier in der Innenstadt?“ fragte ich den Rezeptionisten. Sein Name war William, er war ein junger Schwarzafrikaner, der seinen Dienst mit großer Zuverlässigkeit versah und den Touristen Taxifahrer für Stadtrundfahrten vermittelte. Williams Hemd war faltenlos gebügelt, die Krawatte saß wie angeschweißt, seine langen, schlanken Hände waren gepflegt. „Manchmal geschieht so etwas nach Anbruch der Dunkelheit“, antwortete er mit einer sonoren Stimme. „Meistens handelt es sich um Drogensüchtige, die Geld für ihre tägliche Ration benötigen“, fügte er hinzu. „Tik?“ fragte ich. „Ja, Tik und alles Mögliche“, antwortete er. „Aber die Polizei hat die Lage im Griff.“
Da hatte ich meine Zweifel, denn bekanntermaßen war die Polizei chronisch unterbezahlt und für Mauscheleien und Schiebungen anfällig, Kaum ein Tag verging, in dem nicht ein entsprechender Fall im Fernsehen oder in den Tageszeitungen veröffentlicht wurde. Was sollten sich die Polizisten denn auch an Recht und Gesetz halten, wenn selbst der Präsident korrupt war? Als ich den Wagen aus der Tiefgarage fuhr, wartete ich an einer Kreuzung. Die Ampelanlage war ausgefallen, ein Polizist versuchte, den Verkehr zu regeln, doch niemand achtete auf seine Signale.
***
„Das Wetter ist das Einzige, was sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert hat“, hieß es in Kapstadt. Wenigstens das schien zu stimmen. Ein strahlender Himmel wölbte sich über der Stadt, keinerlei Schwüle war zu spüren, denn die Wärme des Indischen Ozeans wurde durch die kühlen Winde des kalten atlantischen Benguela-Stroms gemildert. Gemeinsam erzeugten sie eine Atmosphäre der Mediterranität, für die Kapstadt berühmt war. Auch von den Smogproblemen, unter denen andere afrikanische Großstädte litten, blieb Kapstadt verschont, denn der "Cape-Doctor", wie die Einheimischen den Wind von Kapstadt nannten, zog wie eine immerwährende Frischluftzufuhr durch die Stadt. Allerdings erzeugte der Cap Doktor zugleich eine nahezu notorische Wolke über dem Wahrzeichen Kapstadts, dem Tafelberg. „Tischtuch des Teufels“ nannten die Capetonians die schwarzdunkle Wolkenfront, die tatsächlich wie eine zu lang geratene Tischdecke über die Ränder des Tafelberges schwappte und fast bis an die Dächer der Wohnviertel reichte.
Читать дальше