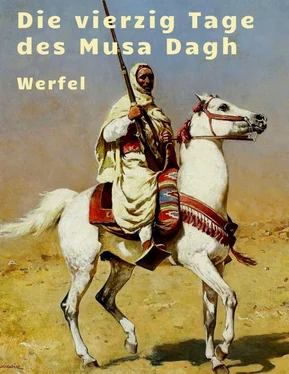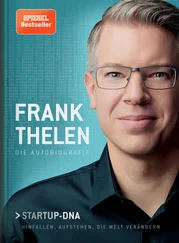Franz Werfel - Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh
Здесь есть возможность читать онлайн «Franz Werfel - Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dieses E-Book enthält eine vollständige Ausgabe des Werkes «Die vierzig Tage des Musa Dagh» von Franz Werfel.
Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Altouni befestigte die Laterne an seinem Gürtel und schnallte ihn um:
»Ich habe mir mindestens siebenmal im Leben einen neuen Teskeré erbitten müssen. Sie nehmen ihn wegen der Taxe fort, die sie bei der Neuausstellung jedesmal gewinnen. Es ist eine bekannte Sache. Von mir aber bekommen sie nichts mehr. Ich brauche auf dieser Welt keinen neuen Paß ...«
Und schartig fügte er hinzu:
»Und früher hätte ich ihn auch nicht gebraucht. Denn seit vierzig Jahren bin ich nicht weggekommen von hier.«
Bagradian wandte den Kopf zur Tür: »Was sind wir für ein Volk, daß wir alles schweigend hinnehmen?«
»Hinnehmen?« Der Arzt kostete das Wort aus: »Ihr Jungen wißt nichts mehr vom Hinnehmen. Ihr seid in anderen Zeiten groß geworden.«
Gabriel aber blieb bei seiner Frage:
»Was sind wir für ein Volk?«
»Du, liebes Kind, hast dein Leben in Europa zugebracht. Und auch ich, wäre ich damals nur in Wien geblieben! Es ist mein großes Unglück, daß ich nicht in Wien geblieben bin. Aus mir hätte vielleicht etwas werden können. Aber, siehst du, dein Großvater war der gleiche Narr wie dein Bruder und hat von der Welt dort draußen nichts wissen wollen. Ich habe mich schriftlich verpflichten müssen, zurückzukommen. Das war mein Unglück. Besser wär's gewesen, er hätte mich nie fortgeschickt ...«
»Man kann nicht immer nur als Fremder unter Fremden leben.«
Der Pariser Gabriel wunderte sich über seine Worte. Altouni lachte heiser:
»Und hier, hier kann man leben? Wo das Ungewisse immer hinter uns her ist? Du hast es dir wohl anders zusammengeträumt.«
Da ging es Bagradian durch den Kopf: Irgendwelche Vorbereitungen müssen getroffen werden. Altouni aber legte seine Tasche auf den Stuhl zurück:
»Verflucht! Was für Sachen reden wir da? Du ziehst heute die alten Geschichten aus mir heraus. Ich bin Mediziner und hab niemals besonders stark an Gott geglaubt. Und doch habe ich früher deshalb mit Gott oft und oft gehadert. Man kann Russe sein und Türke und Hottentotte und Gott weiß was, aber Armenier kann man nicht sein. Armenier sein ist eine Unmöglichkeit ...«
Er riß sich mit einem Ruck von dem Abgrund los, an dessen Rand er geraten war:
»Schluß! Lassen wir das! Ich bin der Hekim. Alles andere geht mich nichts an. Eben hat man mich aus dieser angenehmen Gesellschaft zu einer Frau gerufen, die in den Wehen liegt. Immer wieder, siehst du, werden armenische Kinder zur Welt gebracht. Es ist verrückt.«
Er packte grimmig seine Tasche. Dieses Gespräch zwischen Tür und Angel, das um die Grundlagen ging, schien ihn erbittert zu haben:
»Und du, was willst du! Du hast eine wunderschöne Frau, einen geratenen Sohn, keine Sorgen, bist ein steinreicher Mann, was willst du? Lebe dein Leben! Kümmere dich nicht um die faulen Dinge! Wenn die Türken Krieg haben, lassen sie uns in Ruhe, das ist eine alte Erfahrung. Und nach dem Krieg wirst du nach Paris zurückkehren und von uns und dem Musa Dagh nichts mehr wissen.«
Gabriel Bagradian lächelte, als nehme er seine Frage selbst nicht ernst:
»Und wenn sie uns nicht in Ruhe lassen, Väterchen?«
Gabriel stand einen Augenblick unbemerkt in der Tür des großen Gesellschaftsraumes. Etwa ein Dutzend Menschen waren versammelt. An einem kleinen Tischchen saßen drei ältere Frauen schweigend beieinander, zu denen sich, wahrscheinlich in Juliettes Auftrag, der Student Awakian gesellt hatte. Doch auch er bemühte sich nicht, eine Unterhaltung in Gang zu bringen. Eine dieser Matronen, die Frau des Arztes, war eine der überlebenden Gestalten aus Gabriels Kindheit. Mairik Antaram, Mütterchen Antaram, nannte er sie. Sie trug ein schwarzes Seidengewand. Ihr aus der Stirn gestrichenes Haar war noch nicht ganz ergraut. Das breitknochige Gesicht hatte einen kühnen Ausdruck. Wenn sie auch nicht sprach, so saß sie gelassen da und ließ ihren frei beobachtenden Blick auf den Menschen ruhen. Das gleiche konnte man von ihren beiden Nachbarinnen, der Frau des Pastors Harutiun Nokhudian aus Bitias und der Frau des Schulzen, des Muchtars von Yoghonoluk, Thomas Kebussjan, nicht behaupten. Man sah ihnen an, daß sie sich angestrengt und nicht frei fühlten, obgleich sie aus ihrer Garderobe so manches Prachtstück hervorgeholt hatten, um vor den Augen der Französin in Gnaden zu bestehen.
Frau Kebussjan hatte es am schwersten, denn obgleich sie auch zu jenen gehörte, welche bei den amerikanischen Missionaren in Marasch zur Schule gegangen waren, verstand sie kein Wort Französisch.
Sie blinzelte zu dem verschwenderischen Kerzenlicht der Lüster und Appliken empor. Ah, Madame Bagradian hatte es nicht nötig, zu sparen. Wo bekam man solche dicke Wachskerzen her? Die mußten aus Aleppo oder gar aus Stambul bezogen sein. Der Muchtar Kebussjan war zwar der reichste Landwirt des Bezirks, in seinem Haus aber durften neben dem Petroleum nur dünne Talgkerzen und Lichte aus Hammelfett verwendet werden. Und dort neben dem Klavier brannten sogar in hohen Standleuchten zwei bemalte Wachsstöcke wie in der Kirche. Ob das nicht zu weit ging!?
Dieselbe Frage stellte sich die Pastorin, deren Selbstbewußtsein sehr gedrückt war. Doch muß zu ihrer Ehre gesagt werden, daß sich in ihre Gefühle kein Neid und keine Scheelsucht mischten. Die Hände der Frau lagen mit deutlichem Gewissenskummer im Schoß, weil sie zu Ehren dieses Abends ihre Handarbeit zu Hause gelassen hatte, die sie sonst nie beiseite legte. Die Pastors- und die Muchtarsfrau blickten nach ihren Männern hin und verwunderten sich über diese Alten.
Und tatsächlich, sowohl der zarte Pastor als auch der massive Muchtar waren in ihrem Wesen ganz verwandelt. Sie bildeten einen Bestandteil der Männergruppe, die sich um Juliette scharte. (Sie erklärte der Gesellschaft gerade einige der Antiken, die Gabriel entdeckt und in diesem Raum zur Schau gestellt hatte.) Die beiden gesetzten Herren drehten ihren Ehefrauen den Rücken, das heißt die Kehrseite ihrer altertümlichen Schlußröcke zu, die sich dienstfertig spannten. Insbesondere Pastor Nokhudian schien immerfort auf dem Sprunge zu sein, einen Befehl Juliettens, der aber nicht erfolgte, unerbittlich auszuführen. Er stand freilich in gemessener Entfernung von ihr, da ihn die jungen Leute abgedrängt hatten. Unter diesen fielen zwei Lehrer auf. Hapeth Schatakhian war der eine, der einst mehrere Wochen in Lausanne verbracht hatte und sich seither einer hervorragenden Aussprache des Französischen bewußt war. Er versäumte auch die herrliche Gelegenheit nicht, von seiner Kunst begeistert Zeugnis abzulegen. Der andere Lehrer hieß Hrand Oskanian. Ein Knirps, dem das Schwarzhaar tief in die Stirn wuchs. Er setzte der verschwenderischen Virtuosität seines Gefährten Schatakhian ein durchdringendes Schweigen entgegen. Dieses Schweigen war aufgebläht bis zum Platzen. Unausgesetzt schien es darauf hinzuweisen, wo die dreiste Oberflächlichkeit und wo der wahre Wert zu finden sei. Diesmal hatte Oskanians hochgradiges Schweigen seine verwirrende Macht über Schatakhian eingebüßt. Als Gabriel in den Raum trat, hörte er das lautschallende Französisch des akzentstolzen Lehrers:
»Oh, Madame, wie müssen wir Ihnen dankbar sein, daß Sie einen Strahl der Kultur in unsere Wüste gebracht haben!«
Juliette hatte heute einen kleinen inneren Kampf auszufechten gehabt. Es handelte sich dabei um das Kleid, das sie zum Empfang ihrer neuen Landsleute anzulegen gedachte. Bisher hatte sie sich zu dieser Gelegenheit stets besonders einfach gekleidet, denn es war ihr unwürdig oder überflüssig erschienen, diese »ahnungslosen Halbwilden« zu blenden. Doch schon das letztemal hatte sie bemerkt, daß der Zauber, den sie auf ihre Gäste ausübte, auf sie selbst zurückschlug. So widerstand sie denn der Versuchung nicht und zog ihr größtes Abendkleid hervor. (Ach, es ist vom vorigen Frühjahr, dachte sie bei der Musterung, und zu Hause dürfte ich es nicht wagen, mich darin zu zeigen.) Nach kurzem Zögern legte sie, was ja bei einer glänzenden Gewandung unerläßlich ist, auch noch ihren Schmuck an. Die Wirkung ihres absichtsvollen Entschlusses, dessen sie sich anfangs ein wenig geschämt hatte, überraschte sie selbst. Eine schöne Frau unter schönen Frauen zu sein, dies ist wohl ein hochgemutes Gefühl, doch es befriedigt nicht gar zu lange. Man ist ja nur eine unter vielen, man spielt auf den Promenaden, in den Theatersälen und Restaurants jener fernen westlichen Welt doch nur die Rolle einer hübschen Statistin in einem riesigen Chor. Aber hier, ein unerreichtes Gnadenbild zu sein unter fremdartigen Gläubigen, ein berückendes Palladium für diese schüchtern-großäugigen Armenier, die Einzigartige, die Goldblonde, die Herrin, das ist kein alltägliches Schicksal, das ist ein Erlebnis, das die Wangen jugendlich rötet, die Lippen glühen macht und die Pupillen erglänzen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Franz Werfel - Die vierzig Tage des Musa Dagh» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.