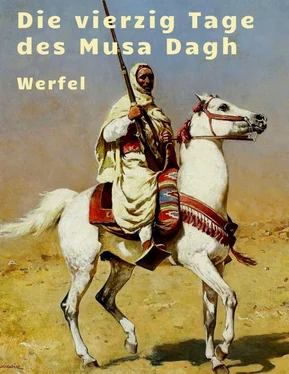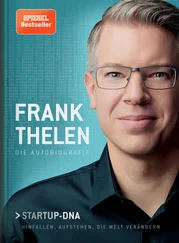Wärme für seine Landsleute stieg in Gabriel Bagradian auf: Mögt ihr euch noch lange freuen, morgen, übermorgen ...
Und er grüßte sie vom Pferde herab mit einer ernsten Handbewegung.
In kühler Sternenfinsternis stieg er den Parkweg zur Villa empor. Das Gehäuse der dichten Bäume umschloß ihn wie jener gute »abstrakte Zustand«, wie das »Mensch-an-sich-Sein«, aus dem ihn dieser Tag gerissen hatte, um ihn den Wahn solcher Geborgenheit fühlen zu lassen. Mit der Müdigkeit wurde der angenehme Aberglaube wieder stärker. Er trat in die große Haushalle. Die alte, schmiedeeiserne Laterne, die von der Höhe herabhing, erfreute mit ihrem matten Licht sein Herz. In einer unbegreiflichen Verflechtung des Bewußtseins wurde sie zu seiner Mutter. Nicht die ältere Dame, die ihn in einer charakterlosen Pariser Wohnung mit einem Kuß empfangen hatte, wenn er aus dem Gymnasium kam – sondern jene schweigsame Milde aus Tagen, die wesenloser waren als Träume. »Hokud madagh kes kurban.« Hatte sie wirklich diese abendlichen Worte gesprochen, über sein Kinderbett gebeugt? »Möge ich für deine Seele zum Opfer werden.«
Nur noch eine zweite Milde war aus der Urzeit da. Das Lichtchen unter der Madonna in der Treppennische. Sonst gehörte alles der Epoche des jüngeren Awetis an. Dies aber war, was zumindest die Treppenhalle anbelangt, ein Zeitalter der Jagd und des Krieges. Trophäen und Waffen hingen an den Wänden, eine ganze Sammlung altertümlicher Beduinenflinten mit endlosen Läufen. Daß der Sonderling aber nicht nur ein Mann der rauhen Leidenschaft gewesen, das bewiesen ein paar herrliche Stücke, Schränke, Teppiche, Leuchter, die er von seinen Fahrten heimgebracht hatte und die das Entzücken Juliettes bildeten.
Während Gabriel in seiner Benommenheit die Treppe zum Stockwerk hinanstieg, hörte er kaum den Stimmenklang, der aus den unteren Räumen kam. Die Notabeln von Yoghonoluk waren schon versammelt. In seinem Zimmer stand er lange am offenen Fenster und starrte regungslos auf die schwarze Silhouette des Damlajik, die sich um diese Stunde gewaltig aufplusterte. Nach zehn Minuten erst läutete er dem Diener Missak, den er gleich dem Verwalter Kristaphor, dem Koch Howhannes und dem übrigen Haus- und Wirtschaftspersonal nach dem Tode des Bruders in seine Dienste übernommen hatte.
Gabriel wusch sich von Kopf bis zu Füßen und kleidete sich um. Dann ging er in Stephans Zimmer. Der Junge war bereits zu Bett gegangen und schlief so kindlich fest, daß ihn nicht einmal der bissige Strahl der Taschenlampe erwecken konnte. Die Fenster standen offen und draußen bewegten sich die Laubmassen der Platanen mit ahnungsvoller Langsamkeit. Auch hier blickte die schwarze Wesenheit des Musa Dagh in den Raum. Nun aber war die Kammlinie des Berges sanft aufgeglommen, als verberge er anstatt des Wasser-Meeres ein Meer von jenseitigleuchtendem Stoff hinter seinem Rücken. Bagradian setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett. Und wie am Morgen der Sohn den Schlaf des Vaters belauscht hatte, so belauschte der Vater jetzt des Sohnes Schlaf. Dies aber war erlaubt.
Die Stirne Stephans, Gabriels eigene Stirn, schimmerte durchsichtig. Darunter lagen die Schatten der geschlossenen Augen wie zwei Blätter, von draußen auf dieses Antlitz geweht. Wie groß diese Augen waren, sah man auch jetzt, da sie schlummerten. Die spitze, schmale Nase gehörte dem Vater nicht an, war Juliettes Erbteil, fremd. Stephan atmete schnell. Die Wand seines Schlafes verbarg ein rauschendes Leben. Die zu Fäusten geballten Hände drückte er fest gegen seinen Körper, als müsse er die Zügel anziehen, damit ihm die galoppierenden Traumerlebnisse nicht durchgingen.
Der Schlaf des Sohnes wurde unruhiger. Der Vater rührte sich nicht. Er sog sich voll mit dem Bild seines Kindes. Hatte er Angst um Stephan? Wollte er eine Einheit herstellen, die einst in Gott lag? Er wußte nichts. Keine Gedanken waren in ihm. Endlich stand er auf, wobei er einen Seufzer nicht unterdrücken konnte, so zerschlagen fühlte er sich. Während er sich unsicher hinaustastete, stieß er gegen den Tisch. Die Nacht übertrieb den kurzen Lärm. Gabriel stand still. Er fürchtete, Stephan geweckt zu haben. Die schlaftrunkene Knabenstimme lallte auch aus dem Dunkel:
»Wer ist hier? ... Papa ... du ...«
Sogleich aber wurden die Atemzüge wieder ruhig. Gabriel, der die Taschenlampe sofort ausgeschaltet hatte, knipste sie nach einer Weile wieder an, wobei er das kleine Licht mit der Hand abblendete. Es fiel auf den Tisch und auf einige Zeichenblätter. Siehe, Stephan hatte sich schon an die Arbeit gemacht und auf des Vaters Wunsch ein Croquis des Musa Dagh mit ungelenker Hand entworfen. Die roten Verbesserungen Awakians durchkreuzten reichlich die Linien. Bagradian erinnerte sich zuerst der Anregung gar nicht, die er bei dem morgendlichen Zusammentreffen dem Jungen gegeben hatte. Dann aber empfand er den stürmischen Eifer, mit dem das Kind ihn suchte und überzeugen wollte. Der kritzlige Entwurf wurde zum Sinnbild.
Vor dem großen Empfangszimmer der Villa Bagradian zu Yoghonoluk befand sich ein großer Raum, der an die Treppenhalle grenzte. Er war ziemlich kahl und wurde nur als Durchgangszimmer benützt. Awetis, der Alte, hatte seine Residenz für eine zahlreiche Nachkommenschaft berechnet, so daß sowohl der einsame Sonderling als zuletzt die kleine Familie, die übriggeblieben war, nur einen Teil der vorhandenen Wohnräume in Verwendung nehmen konnte. In dem kahlen Durchgangszimmer brannte eine herabgeschraubte Petroleumlampe. Gabriel blieb einen Augenblick stehn und lauschte den Stimmen daneben. Er hörte Juliette lachen. Die Bewunderung dieser dörflichen Armenier da drin tat ihr also wohl. Ein Fortschritt.
Der alte Arzt Bedros Altouni öffnete eben die Tür, um sich davonzumachen. Er zündete die Kerze in seiner Laterne an und griff nach seiner Ledertasche, die auf einem Stuhl lag. Altouni bemerkte den Hausherrn erst, als dieser ihn leise anrief: »Hairik Bedros!«, Väterchen Bedros! Der Arzt schrak zusammen. Er war ein kleiner, dürrer Mann mit einem unordentlichen Graubart; er gehörte noch zu jenen Armeniern, die, anders als die jüngere Generation, auf ihren gebeugten Schultern die ganze Last des verfolgten Stammes zu tragen schienen. Als Schützling Awetis Bagradians hatte er in seiner Jugend auf dessen Kosten in Wien Medizin studiert und die Welt gesehen. Damals trug sich der Wohltäter Yoghonoluks mit großen Plänen und dachte sogar an die Errichtung eines kleinen Hospitals. Es blieb aber nur bei der Bestallung des Bezirksarztes, was angesichts der allgemeinen Verhältnisse schon überaus viel war. Von allen lebenden Menschen kannte Gabriel den alten Arzt, den alten »Hekim«, am längsten, denn dieser hatte bei seiner Geburt mitgewirkt. Er besaß einen zärtlichen Respekt für den Arzt, jedenfalls ein Erbteil von Kindheitsgefühlen. Doktor Altouni mühte sich mit einem Lodenmantel ab, der noch aus seiner Wiener Universitätszeit zu stammen schien.
»Ich konnte nicht mehr länger auf dich warten, mein Kind ... Nun, was hast du im Hükümet herausgebracht?«
Gabriel richtete den Blick auf das eingeschrumpfte Gesichtchen. Alles an dem alten Mann war schartig. Seine Bewegungen, seine Stimme, ja selbst die Schärfe, die seine Worte manchmal zeigten. Er war äußerlich und innerlich abgewetzt. Der Weg von Yoghonoluk nach Holzdorf auf der einen und nach Bienendorf auf der anderen Seite zog sich verdammt, wenn man ihn mehrmals wöchentlich auf dem harten Rücken eines Esels zurücklegen mußte. Gabriel erkannte die ewige Ledertasche, in der neben Heftpflaster, Fieberthermometer, chirurgischem Besteck und einem deutschen ärztlichen Handbuch aus dem Jahre 1875 nur noch eine vorsintflutliche Geburtszange lag. Angesichts dieser medizinischen Tasche schluckte er die Anwandlung hinunter, seine Erfahrungen in Antiochia preiszugeben.
»Nichts Besonderes«, antwortete er wegwerfend.
Читать дальше