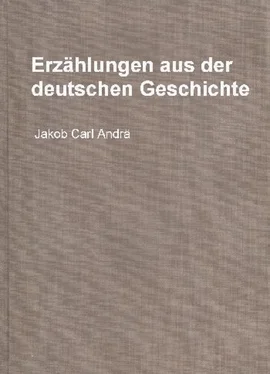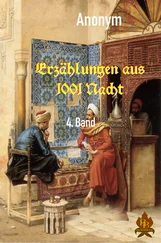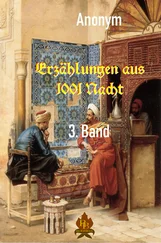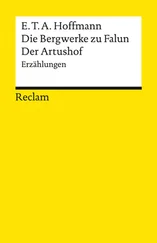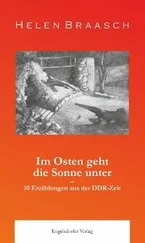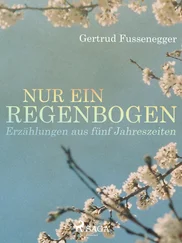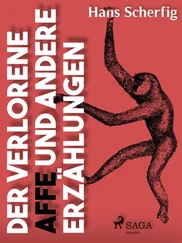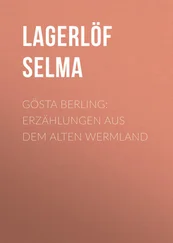Otto Hoffmann - Erzählungen aus der deutschen Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Otto Hoffmann - Erzählungen aus der deutschen Geschichte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Erzählungen aus der deutschen Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erzählungen aus der deutschen Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Erzählungen aus der deutschen Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Errungenschaften ihrer Zeit.
Der Indogermanist Dr. Otto Hoffmann steuerte für den Anhang Nacherzählungen von zwei der schönsten deutschen Heldensagen bei, das Nibelungenlied und die Gudrun-Sage.
Mit 4 Geschichtskarten und 8 schwarz-weißen Bildtafeln.
Erzählungen aus der deutschen Geschichte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Erzählungen aus der deutschen Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2. Konradin.Dem höchsten Glanze des deutschen Kaisertums folgte bald der Verfall. Die letzten vier hohenstaufischen Kaiser, Heinrich VI., Philipp von Schwaben, Friedrich II. und Konrad IV., kämpften fortwährend in Italien, namentlich mit den Päpsten. Es war ein langes furchtbares Ringen, in dem die kaiserliche Macht der stärkeren päpstlichen Gewalt zuletzt erlag. Nach Konrads IV. Tode war von dem hohenstaufischen Hause nur noch ein unmündiger Knabe übrig, Konradin, d. i. der kleine Konrad. Dessen Erbland, das Königreich Neapel, gab der Papst einem französischen Prinzen. Sobald Konradin in Deutschland zum Jüngling herangewachsen war, zog er mit einem Heere aus, um sein väterliches Erbe wieder zu erobern. Allein er ward geschlagen, gefangen genommen und in Neapel mit seinem treuen Freunde Friedrich von Baden hingerichtet. So unglücklich endete das glorreiche Geschlecht der Hohenstaufen (1268).
3. Ende und Folgen der Kreuzzüge.Nach Barbarossas verhängnisvollem Zuge in das heilige Land wurden noch mehrere Kreuzzüge unternommen, allein sie hatten keinen dauernden Erfolg. Nach und nach kamen alle christlichen Besitzungen in Palästina wieder in die Hände der Türken. Das war der Ausgang der Kreuzzüge, die beinahe 200 Jahre gedauert und sechs Millionen Christen das Leben gekostet haben. Trotzdem waren diese Heereszüge von den wichtigsten Folgen für ganz Europa. Durch sie lernte man viele bis dahin ganz fremde Länder kennen und mit diesen zugleich die Sitten, Gebräuche und Einrichtungen andrer Völker. Manche Erzeugnisse des Morgenlandes wurden nach Europa gebracht, manche Kunst dahin verpflanzt. Besonders wichtig wurde der Handelsverkehr, der seit jener Zeit von den europäischen Ländern am Mittelmeere mit Asien getrieben wurde. Von den Seestädten Italiens, namentlich von Venedig, der Königin des Meeres, gingen ganze Flotten nach dem Morgenlande, führten Kriegsheere dahin und versorgten die Kreuzfahrer mit Lebensmitteln. Dabei nahm der Handel einen mächtigen Aufschwung, und zahlreiche Städte gelangten durch ihn zu blühendem Wohlstande. — Vor allem aber förderten die Kreuzzüge die Macht der Kirche und des Papstes. Sie wurden ja von der Kirche angeregt, zu ihrer Ausbreitung und Verherrlichung unternommen, und die Päpste galten als ihre obersten Leiter. Hierdurch wurde erreicht, was Gregor VII. erstrebt hatte: der Glanz der päpstlichen Gewalt verdunkelte alle weltliche Macht und Herrschaft, der Papst erschien als der gemeinsame höchste Herrscher der gesamten Christenheit, vor dem sich Kaiser und Könige beugten. — Endlich hatten die Kreuzzüge eine große Bedeutung für das Ritterwesen.
24. Das Ritterwesen. Die Städte.
1. Entstehung des Rittertums.Das Rittertum hatte sich seit der Zeit König Heinrichs I. aus dem Reiterdienste entwickelt, der als besonders ehrenvoll galt. Ihm widmeten sich die Reichen und Adeligen, die den Kriegerstand zu ihrem Lebensberufe machten. Schwer gerüstet, von Kopf bis zu Füßen mit Eisen bedeckt, von Jugend auf im Gebrauche der Waffen geübt, waren sie den gemeinen Kriegern, die zu Fuße dienten, weit überlegen: fast einzig auf ihrer Anzahl beruhte die Stärke des Heeres. Von ihrem Reiterdienst erhielten sie den Namen Ritter. Die Ritter wohnten in Burgen, die meist auf Berghöhen, aber auch auf ebenem Lande erbaut waren (s.Tafel II u. III).
2. Edelknabe, Knappe und Ritter.Die Zeit der Kreuzzüge war die Blütezeit des Rittertums. Um diese Zeit bildeten die Ritter einen besondern Stand mit besondern Pflichten. Der Ritter mußte seine Ehre unbefleckt erhalten, der Kirche gehorsam sein und ihre Diener beschützen, den Schwachen und Bedrängten Beistand leisten und den Frauen Hochachtung und Höflichkeit erweisen. Die Aufnahme in den Ritterstand erfolgte erst nach langjähriger Vorbereitung. Vom siebenten Jahre an trat der Knabe als Edelknecht oder Page in den Dienst eines Ritters. Hier lernte er Zucht und Gehorsam, namentlich im Dienste der Edelfrau, wartete bei der Tafel auf und begleitete die Herrin auf die Jagd und auf Reisen. Daneben übte er sich fleißig im Reiten und in den Waffen. In seinem vierzehnten Jahre wurde der Edelknabe Knappe und empfing das Schwert, um fortan den eigentlichen Waffendienst in strengeren Übungen zu erlernen. Als Waffenträger folgte er jetzt seinem Herrn überall hin, zum heitern Kampfspiel und in den Ernst der Schlacht. Dem Herrn treu anzuhangen, im Kampfe sein Leben für ihn einzusetzen, das galt ihm als die erste seiner Pflichten. Nach siebenjährigem Knappendienste wurde der Jüngling zum Ritter geschlagen. Das war ein hohes Fest. Am Tage zuvor mußte der Knappe fasten und die Nacht unter andächtigem Gebete in der Kirche zubringen. Am Festtage leistete er dann vor einer glänzenden Versammlung von Rittern und Edelfrauen das feierliche Gelübde, der Ritterpflichten stets eingedenk zu sein, worauf ihm ein bewährter Ritter mit der flachen Klinge drei leichte Schläge auf die Schulter gab. Das nannte man den Ritterschlag. Nun wurden dem jungen Ritter außer dem Schwerte die übrigen Waffenstücke überreicht: die Lanze, der Helm mit Visier und Helmbusch, der Panzer, der gestickte Waffenrock, die farbige Schärpe, Handschuhe und goldne Sporen. Ein festliches Gelage beschloß den Tag.
3. Turniere.Zur Erhaltung ritterlichen Sinnes dienten besonders die Turniere. Das waren festliche Waffenspiele, die den Rittern Gelegenheit gaben, Proben ihrer Tapferkeit und Gewandtheit abzulegen und Ruhm und Beifall von einer schaulustigen Menge öffentlich einzuernten. Nur Ritter von untadeligen Sitten durften daran teilnehmen. Der Turnierplatz war von Schranken umgeben, hinter denen das Volk stand. Die Fürsten und Edelfrauen saßen auf reichverzierten Schaubühnen. Unter Trompetenklang und Paukenschlag ritten die ganz in Eisenpanzer gehüllten Ritter paarweise in die Schranken. Nun rief ein Herold das erste Fechterpaar zum Lanzenstechen auf. Mit eingelegter Lanze stürmten die beiden Kämpfer gegeneinander an, jeder suchte den andern vom Rosse zu werfen. Saßen sie beide fest im Sattel, so zersplitterten oft die Lanzen an den stählernen Brustharnischen; zuweilen flogen beide Ritter zur Erde, zuweilen wurde einer samt seinem Pferde rücklings zu Boden geworfen. Mancher brach dabei Arm und Bein oder gar den Hals. Nach dem ersten Kämpferpaare wurde das zweite aufgerufen, dann das dritte, vierte, und so ging es tage-, ja wochenlang fort. Manchmal rückten die Ritter auch in ganzen Scharen gegeneinander los. Nach dem Lanzenstechen folgte der Schwertkampf zu Fuß und zu Roß. Den Schluß machte ein sogenanntes Gesellenstechen zur Übung der Knappen.
4. Der Sieger Lohn.Wer sich beim Turnier am meisten hervorgethan hatte, erhielt aus den Händen der vornehmsten und schönsten Dame den Dank oder Preis, der in wertvollen Waffenstücken, einer goldnen Kette, einem kostbaren Ringe und dergleichen Schmuck bestand. Dann ward der Sieger feierlich in das Schloß geleitet. Hier nahmen ihm die Edelfrauen die schwere Rüstung ab und schmückten ihn mit Prachtkleidern. Bei dem Festmahle erhielt er den Ehrenplatz, und später beim Tanz eröffnete er den Reigen. Fürsten und vornehme Ritter entfalteten bei den Turnieren oft einen außerordentlichen Glanz. So setzte einst ein Graf als ersten Preis 100 000 Goldstücke aus, die der Sieger sogleich unter 100 Ritter verteilte. Ein anderer ließ auf dem Turnierplatze einen ganzen Baum von Silber mit goldnen Blättern aufpflanzen. Jeder Ritter, der seinen Gegner aus dem Sattel hob, erhielt zum Dank ein goldenes Blatt.
5. Die Ritterfrauen. Die heilige Elisabeth.Die Frauen der Fürsten und Ritter führten auf den einsamen Burgen ein ziemlich einförmiges Leben. An den ritterlichen Unterhaltungen und Belustigungen konnten sie nur selten teilnehmen; der Besuch eines Turniers war schon der umständlichen, oft gefährlichen Reise wegen eine schwierige Sache. Wohl aber ritten sie viel zur Jagd, den Falken auf der Faust, um mit diesem abgerichteten Raubvogel Reiher zu fangen (Reiherbaize). Sonst erzogen sie in der Abgeschlossenheit ihrer Frauengemächer (Kemnate) die Töchter, beaufsichtigten die weibliche Dienerschaft, übten sich in kunstvollen Stickereien und ließen sich von fahrenden Sängern Geschichten und Lieder vortragen. Auch der des Lesens und Schreibens kundige Burggeistliche war ihnen eine wichtige Persönlichkeit. Manche Frauen führten ein frommes, ganz der Nächstenliebe gewidmetes Leben. Unter diesen frommen Frauen ist besonders bekannt die heilige Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Sie war die Tochter eines ungarischen Königs und kam als Kind nach der Wartburg, an den heitern liederreichen Hof des Landgrafen Hermann von Thüringen, um zur Gemahlin seines Sohnes erzogen zu werden. In früher Jugend schon spendete sie Verlassenen und Hungrigen reiche Gaben, verschmähte für sich alle irdischen Genüsse und unterwarf sich frommen Bußübungen, ja schmerzhaften Geißelungen. Armen verfertigte sie Gewänder, Kranke pflegte sie. Nach ihres Gemahls Tode vom Schlosse vertrieben, ging sie mit ihren Kindern betteln. Sie starb, erst 24 Jahre alt, in Marburg (1231), wo über ihrem Grabe die schöne Elisabethkirche erbaut wurde.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Erzählungen aus der deutschen Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Erzählungen aus der deutschen Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Erzählungen aus der deutschen Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.