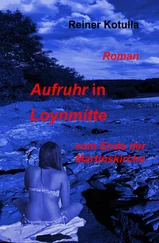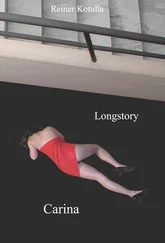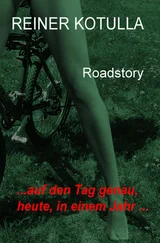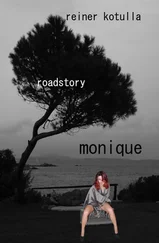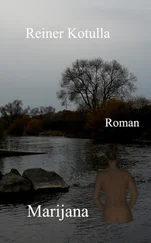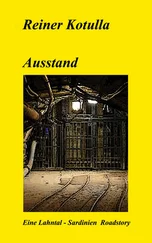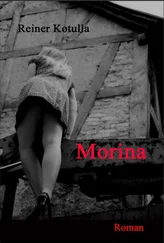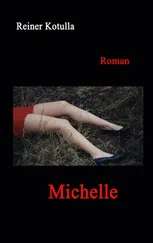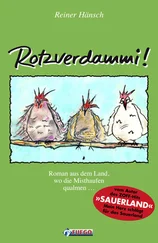Am dritten Tag, sie hatten sich inzwischen häuslich eingerichtet, hätten sie am nahen Waldrand Bewegungen beobachtet, nach den Gewehren gegriffen und seien in Stellung gegangen. Es wären Kinder gewesen, die sich nun zögernd dem Dorf näherten.
Der Leutnant hatte Posten eingeteilt, denn man wisse ja nie, hätte er gesagt, die Bolschewiken würden nicht davor zurückschrecken, Kinder als Schutzschild zu benutzen.
Doch die waren nähergekommen, und es hatte den Anschein gehabt, als würden sie ihr Spiel fortsetzen, das sie vor ihrer Flucht aus dem Dorf begonnen hatten.
Sie erschraken, als sie das Haus betraten und die fremden Soldaten erblickten. Dann seien sie doch näher gekommen und hätten Fragen gestellt. Zuerst hätten die Landser sie nicht verstanden, sagte mein Opa, doch dann, mit Händen und Füßen, wie er sich ausdrückte, „erkannten wir, dass sie Hunger und Durst hatten.
Wir gaben ihnen von den Vorräten, die wir im Keller gefunden hatten, und bald verloren sie ihre Scheu.“
Der Leutnant habe befohlen, die Kinder nach dem Aufenthaltsort ihrer Eltern zu befragen.
Die Kinder hätten aber zunächst nichts sagen wollen.
Mit einem Jungen, etwa fünfzehn Jahre alt, hatte sich mein Großvater etwas angefreundet. Der habe schließlich doch von seinen Eltern gesprochen, die im Wald, in einer Erdhöhle versteckt, darauf warteten, dass die „Deutschen“ verschwänden.
Bald sei der Artilleriedonner näher gekommen und der Leutnant habe zum weiteren Rückzug geblasen, weil die versprochene Verstärkung nicht eingetroffen war und ihm deshalb der Ausbau von Stellungen sinnlos erschien.
Alles Gerät war verpackt worden, und als sie das Dorf verlassen wollten, hätte der Leutnant befohlen, in allen Häusern, Ställen und Scheunen Sprengladungen anzubringen.
„Und, Susanne, wir haben den Befehl ausgeführt, obwohl ich an Igor denken musste, der dann keine Bleibe mehr haben würde.“
Etwa zweihundert Meter vom Dorf entfernt, in einem Wald, im dichten Unterholz, hielten sie an, um von dort aus die Sprengung vorzunehmen.
Da wären sie aus dem Wald gekommen, zuerst die Kinder, dann die Erwachsenen. Die Kinder seien völlig unbefangen zu den Häusern gerannt, hätten dort auf ihre Eltern gewartet. Die waren vor den Häusern stehen geblieben und hatten zuerst, wie sichernd, in alle Richtungen geblickt.
„Ich dachte noch, hoffentlich entdecken sie die Kabel und flüchten zurück, woher sie gekommen waren. Doch es schneite und bald waren die Drähte wohl im Schnee versunken. Ich sah allen voran die Kinder in die Häuser verschwinden.
Da gab der Leutnant den Befehl – und, Susanne, ich habe nicht gewagt zu protestieren.
In der Nacht fand ich keinen Schlaf. Immer wieder sah ich Igor vor mir, der mir vertraut hatte. Ich begann zu hassen: den verdammten Krieg, die Offiziersclique, deren Befehlen ich bisher widerspruchslos gefolgt war, und den Verbrecher, der diesen Befehl, genannt Verbrannte Erde, erteilt hatte, auf den ich einen heiligen Eid geschworen hatte.
Jetzt erst erinnerte ich mich an den Wahlkampf, als die Kommunisten die Parole ausgegeben hatten: Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, und wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Das hatten wir damals nicht geglaubt. Keiner von uns, auch später nicht, dachte an ein solches Massensterben. Nun war ich selbst zum Kriegsverbrecher geworden. Da fasste ich einen Entschluss.
Am Morgen brachen wir auf. Noch einmal schaute ich zurück auf die rauchenden Trümmer des Dorfes. Der Artilleriedonner war nähergekommen. Versprengte Truppenteile stießen zu uns, in denen der Leutnant die ersehnte Verstärkung zu sehen glaubte. Er ließ uns antreten, hielt eine Rede vom heroischen Kampf gegen die bolschewistischen Untermenschen, die wie Tiere über uns herfielen, würden sie unser habhaft. Aber nun, da wir gestärkt seien, würden wir eine neue Front aufbauen. ‚Wühlen wir uns in die Erde‘, schrie er, ‚und sollten die Russenpanzer uns überrollen, kleben wir ihnen unsere Haftminen unter ihren verdammten Arsch.‘
Wir buddelten. In der Nacht steckte ich mein weißes Unterhemd in die Hosentasche. Auch am nächsten Tag gruben wir weiter. Hundemüde schliefen wir dann ein. In einiger Entfernung von mir hatte sich der Leutnant hingelegt und bald hörte ich sein Schnarchen. Die beiden Wachposten dösten am klein gehaltenen Feuer. Gegen drei Uhr, am Morgen, schlich ich mich davon, in die Richtung, aus der tagsüber der Kanonendonner zu hören gewesen war.
Ich fand einen entsprechend langen Stock, an dem ich mein Unterhemd befestigte. Stunden später erreichte ich, meine Fahne schwenkend, die sowjetischen Linien.
Ich wurde angerufen und antwortete mit einem Wort, das ich von Igor gelernt hatte, „Druschba.“
Meine Abscheu über unsere feige Mordtat war derart, dass der sowjetische Offizier, der mich verhörte, mich nicht auffordern musste, mein Wissen über die Lage an der deutschen Front, so gut ich die kannte, kundzutun.
Und ich sage dir, Susanne, als ein Verräter fühlte ich mich dabei nicht.
Tags darauf wurde ich in ein Gefangenenlager transportiert. Harte Arbeit, wenig Brot.
Wir waren über einhundert Kriegsgefangene. Abends saßen wir zusammen. Man schwärmte von den guten alten Zeiten, prahlte mit seinen Heldentaten. Wenn man ihnen so zuhört, dachte ich, glaubt man kaum, dass sie den Krieg verlieren würden. Ich hielt mich aus solchen Gesprächen heraus.
Einmal sprachen sie auch über die Deserteure, diese Feiglinge, die an den nächsten Baum gehörten. Ich war froh, dass niemand wusste, dass ich ein solcher war.
Ein sowjetischer Offizier stellte mich dann drei anderen Gefangenen vor, die in derselben Lage waren wie ich. Mit ihnen traf ich mich oft nach der Arbeit. Wir sprachen über die Zeit nach dem Ende des Krieges und wir hofften darauf, dass es bald kommen würde. Manchmal kam auch der sowjetische Offizier dazu und informierte uns über die Lage an ihrer Westfront. Dann das Ende des Krieges, die Befreiung auch des deutschen Volkes vom Faschismus Ich ging dorthin, wo das Wort Stalins galt: „Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber, der deutsche Staat bleiben bestehen.“
Einen von den Gleichgesinnten von damals traf ich wieder. Das muss 1952 gewesen sein. Der „Rote Leutnant“, so nannten wir ihn, wenn keiner von den anderen in der Nähe war, erzählte, wir saßen im Stadtcafé, dass er nach seiner Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone, zuerst Bürgermeister seiner Heimatstadt und nach dem Studium der Germanistik Schriftsteller geworden sei. Über den Krieg habe er geschrieben und auch meine Geschichte erzählt, die er „Druschba“ genannt habe.
Zur Sache
Einen sehr guten Beleg dafür, wie mit den Tätern und Mitläufern des deutschen Faschismus nach der Befreiung verfahren wurde, fand ich im jüngsten Buch von Michael Kubi, „Zur Geschichte der Sowjetunion, Bodenfelde 2019“. Den Text habe ich im Original übernommen und die Anmerkungen direkt in ihn eingefügt.
"Den russischen Kommunismus mit dem Nazifaschismus auf die gleiche moralische Stufe zu stellen, weil beide totalitär seien, ist bestenfalls Oberflächlichkeit, im schlimmeren Falle ist es — Faschismus. Wer auf dieser Gleichstellung beharrt, mag sich als Demokrat vorkommen, in Wahrheit und im Herzensgrund ist er damit bereits Faschist und wird mit Sicherheit den Faschismus nur unaufrichtig und zum Schein, mit vollem Hass aber allein den Kommunismus bekämpfen." (Mann, T. (1986) in: Essays, Hg. von H.Kurzke, Frankfurt, Bd. 2, S. 311 ' Zitiert in Hartmann (2007), S. 13)
Während des Kalten Krieges wurde die Totalitarismus-Doktrin, also die unwissenschaftliche Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus, zum Paradigma für die Geschichtswissenschaft. Unter einem Paradigma versteht man die grundsätzliche Denkweise, Lehrmeinung oder Ideologie, die vorherrschend ist. Seitdem dient die Totalitarismus-Doktrin als das Paradebeispiel der Geschichtsschreibung über die Sowjetunion, Stalin und den Sozialismus (und damit auch anderer sozialistischer Staaten wie die DDR) allgemein.
Читать дальше